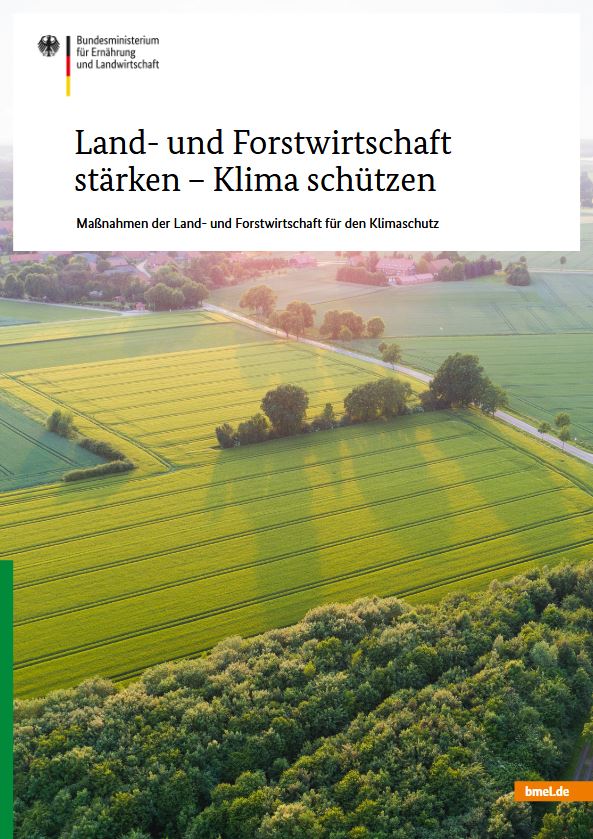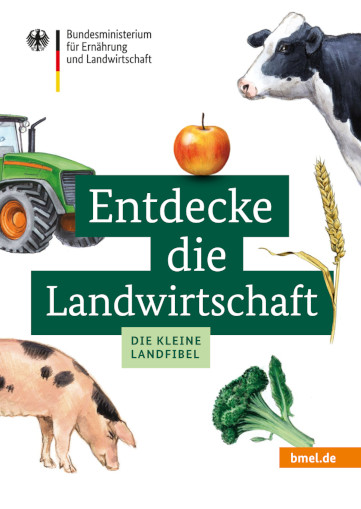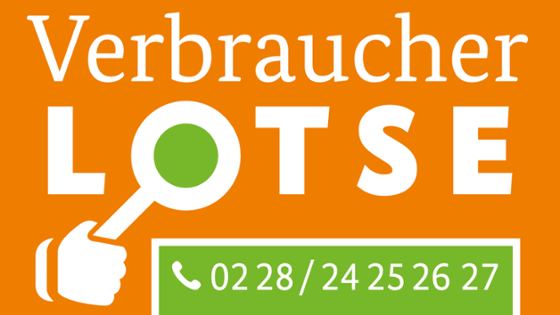Aus "Berichte über Landwirtschaft"
Heft 2, Oktober 2008, Band 86
Ökologie und Konvention - landwirtschaftliche Konzepte im Widerstreit
Von HORST SEEHOFER, BERLIN
Der Gegensatz von ökologischem und konventionellem Landbau beschäftigt die Landwirtschaft schon seit langem. Polarisierung führt nicht zu Lösungen – vielmehr sollte eine Partnerschaft angestrebt werden, aus der beide Anbauweisen wechselseitigen Nutzen ziehen. Der Staat muss verlässliche Rahmenbedingungen für die Landwirte schaffen und kann bestimmte Ziele finanziell fördern. Aber er darf nicht einseitig sein, sondern muss das Gemeinwohl im Auge behalten. Zu beiden Anbauformen gehört der verantwortungsvolle Umgang mit Flora und Fauna. Zugleich bleibt es Hauptaufgabe der Landwirtschaft, auf begrenzten Flächen genügend Nahrung für eine wachsende Bevölkerung zu erzeugen.
Ökologische und konventionelle Landwirtschaft stehen vor den selben großen Herausforderungen – die wachsende Weltbevölkerung, die Bewältigung des Hungers und der Klimaschutz, verbunden mit der globalen Energiesicherheit. Eine Anbaumethode, die für eine Region die richtige Lösung sein kann, muss nicht zwingend das Patenrezept gegen den Hunger in der Welt sein. Zum Klimaschutz gehört auch die kritische Hinterfragung der Transportwege. Regional erzeugte Produkte können eine Lösung sein, aber nicht alles kann aus der Region bezogen werden. Unsere Wirtschaft ist auf dem Export aufgebaut.
Einen wichtigen Beitrag leisten Nachwachsende Rohstoffe – die Energieträger der Zukunft. Unser Ziel sollte sein, alle landwirtschaftlichen Rohstoffe aus dem In- und Ausland unabhängig vom Zweck in ein Zertifizierungssystem einzubeziehen. Gemeinsam mit der Wirtschaft sollten die Methoden der Kennzeichnung vereinbart werden, die dem Verbraucher Auskunft über die gesamte Wertschöpfungskette geben.
Instrumente und Verpflichtungen zur Regelung einer guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft – Das Beispiel der Dokumentation von Pflanzenschutzmittelanwendungen
Von HORST-HENNING STEINMANN, HENNING-WILHELM BATTERMANN und LUDWIG THEUVSEN, Göttingen
Aufzeichnungen über den Einsatz von Produktionsfaktoren sind Kernbestandteile des betrieblichen Managements in der Landwirtschaft. Zahlreiche Regelungen sind in den vergangenen Jahren getroffen worden, um Aufzeichnungspflichten zu etablieren oder sie im Rahmen der guten fachlichen Praxis zu kodifizieren. Der Beitrag gibt am Beispiel der Dokumentation des Pflanzenschutzmitteleinsatzes einen Überblick über die aktuelle rechtliche und praktische Situation in Deutschland.
Kennzeichnend ist die große Fülle von Regelungen die im Ergebnis aber kaum zu einer Klarheit über Art und Weise einer geeigneten Dokumentation führen. Eine fachgesetzliche Regelung durch das Pflanzenschutzgesetz steht erst noch bevor. Bedeutender als die rechtliche Veranlassung zur Dokumentation ist die Nachfrageposition von Handel und nachgelagerter Industrie, die detaillierte Anforderungen an die Produzenten stellen oder Zusicherungen verlangen. Die Situation wird vor dem Hintergrund des aktuell durchgeführten Umfanges der Pflanzenschutzdokumentation in Landwirtschaftsbetrieben diskutiert.
Empirische Analyse der Erfolgsunterschiede ökologisch wirtschaftender Betriebe in Deutschland
Von TAMMO FRANCKSEN und UWE LATACZ-LOHMANN, Kiel
In diesem Beitrag wird der wirtschaftliche Erfolg ökologisch wirtschaftender Betriebe ermittelt sowie die Bestimmungsgründe für Erfolgsunterschiede mittels Diskriminanzanalyse analysiert. Die Analyse basiert auf einem unbalancierten Panel von 2.550 betriebswirtschaftlichen Jahresabschlüssen der Wirtschaftsjahre 1995/96 bis 2005/06 von insgesamt 835 ökologisch wirtschaftenden Betrieben aus Deutschland.
Die Ergebnisse zeigen, dass spezialisierte Milchviehbetriebe die im Durchschnitt der Wirtschaftsjahre erfolgreichste Betriebsgruppe bilden. Am wenigsten erfolgreich sind demgegenüber Betriebe des sonstigen spezialisierten Futterbaus (ohne Milchviehhaltung) sowie Viehhaltungsverbundbetriebe mit Schwerpunkt sonstigem Futterbau. Innerhalb der einzelnen untersuchten Betriebstypen bestehen zum Teil erhebliche Erfolgsunterschiede. Die Bestimmungsgründe für den wirtschaftlichen Erfolg sind vielfältig und häufig von dem jeweiligen Betriebstyp abhängig. Als über alle Betriebstypen hinweg zutreffende Charakteristika erfolgreicher Betriebe zeigen sich ein hohes natürliches Standortpotenzial, die Bewirtschaftung des Betriebes im Haupterwerb sowie ein vergleichsweise hoher Arbeitskräfteeinsatz je ha LF.
Pflanzenöl als Kraftstoff: Rahmenbedingungen, Förderinstrumente und regionale Wertschöpfungspotenziale in Deutschland
Von THOMAS BREUER und ARNO BECKER, Bonn
Die dezentrale Produktion von Pflanzenölen, die in Verbindung mit der Förderung der Biokraftstoffe gesehen werden muss, erlebt in den vergangen Jahren in Deutschland einen rasanten Aufstieg. Die Förderung der Biokraftstoffe ist ein globaler Trend, wobei Deutschland bei der Entwicklung der Pflanzenölkraftstoffe eine Vorreiterrolle einnimmt. Insgesamt handelt es sich bei den Biokraftstoffen allerdings um politische Märkte, die durch die Ausgestaltung der politischen Rahmenbedingungen maßgeblich bedingt werden. Dies wurde bei der Euphorie der vergangenen Jahre teilweise übersehen.
Pflanzenöl als Kraftstoff hat Vorteile (z. B. niedrige Produktionskosten, einfacher Produktionsprozess), aber auch Nachteile (zum Beispiel Flächeneffizienz, Motorenanpassung). Neben der Frage, ob man Pflanzenöl als Kraftstoff einsetzen möchte, stellt sich auch die Frage der Herstellung des Pflanzenöles. Hierbei kann zwischen zentralen und dezentralen Anlagen unterschieden werden. Bei zentralen Anlagen sind die Wertschöpfungspotenziale aus Sicht des landwirtschaftlichen Ölsaatenproduzenten auf die Mehrerlöse aus dem Rapsanbau begrenzt. Bei dezentralen Ölmühlen bietet sich für den landwirtschaftliche Produzenten die Möglichkeit an der Veredelung der Rohstoffe zu partizipieren. Hieraus lässt sich bereits ein möglicher Zielkonflikt bei der Förderung von Biokraftstoffen erkennen. Denn nicht die Markteinführung der Biokraftstoffe an sich ist das Ziel der politischen Unterstützung, sondern die damit einhergehenden wirtschaftlichen, strukturellen oder umweltbeeinflussenden Effekte. Die Akteursvielfalt spiegelt sich in den an der Politikgestaltung beteiligten Politikfeldern wider, welche bestrebt sind ihre jeweiligen Zielpräferenzen einzubringen und umzusetzen.
Die bei der Festlegung der Förderstrategie vorliegenden unterschiedlichen Interessensbereiche erhöhen entscheidend die Gefahr von Zielkonflikten innerhalb der Instrumentarienwahl. Zur weiteren Vermeidung von Unsicherheiten (wie aktuell durch die Besteuerung der Reinbiokraftstoffe) muss eine klare, langfristige und transparente Strategie- und Zieldefinition der Politik erfolgen. Nur diese kann langfristig Investitionssicherheit bieten. Sollte innerhalb einer eindeutigen Zieldefinition die Stärkung des ländlichen Raumes ein starkes Gewicht haben und die Politik bereit sein Mehrkosten durch eine dezentrale Produktion in den Regionen zu tragen, dann können Wertschöpfungspotenziale durch die Veredelung der Rapssaat zu Rapsöl und Presskuchen in der regionalen Landwirtschaft zukünftig erschlossen werden. Im Jahr 2006 könnten diese Mehrerlöse bei etwa 114 Millionen Euro gelegen haben. Die momentan geltende Gesetzgebung (Besteuerung des Pflanzenöls) könnte einen Absatz des Rapsöls als Kraftstoff ab 2009 wirtschaftlich gefährden und den dezentralen Ölmühlen damit die mengenmäßig größte Vermarktungsoption nehmen.
Schlüsselwörter: Pflanzenölkraftstoff, Rahmenbedingungen, Förderinstrumente, Einkommensmöglichkeiten; Ländliche Räume.
Koordination und Kooperation beim Bt-Mais Anbau in Brandenburg – Eine explorative Untersuchung betrieblicher Strategien der Koexistenz
Von NICOLA CONSMÜLLER, VOLKER BECKMANN, CHRISTIAN SCHLEYER, Berlin
Der Maiszünsler (Ostrinia nubilalis) kann im Maisanbau in Deutschland große Schäden verursachen. Bei einer Anbaufläche von rund 1,7 Millionen Hektar Mais in Deutschland beläuft sich die Befallsfläche auf etwa 350.000 ha. Eine Bekämpfung kann mechanisch, chemisch und biologisch durchgeführt werden. Die Wirkungsgrade der einzelnen Bekämpfungsstrategien unterscheiden sich jedoch mitunter stark voneinander. Seit dem Jahr 2006 besitzen auch transgene Maissorten eine Sortenzulassung für den Anbau in Deutschland. Es handelt sich hierbei um gentechnisch veränderten Bt (Bacillus thuringiensis)-Mais, der ein Endotoxin des Bodenbakteriums Bacillus thuringiensis bildet und so in der gesamten Vegetationsperiode vor den Larven des Maiszünslers geschützt ist.
Durch den Anbau von Bt-Mais kann es zur Auskreuzung von transgenen Bestandteilen kommen. Um dennoch die Koexistenz aller Anbauformen zu gewährleisten, soll gemäß dem Subsidiaritätsprinzip jedes EU-Mitgliedsland eigene Regeln im Umgang mit GVO festlegen. Der rechtliche Rahmen des Anbaus von Bt-Mais ist in Deutschland durch das Gentechnikgesetz gegeben. Der Schutz der konventionellen und ökologischen Landwirtschaft vor negativen Auswirkungen der Agro-Gentechnik steht hierbei im Vordergrund. Das Gentechnikgesetz umfasst sowohl Maßnahmen der ex-ante-Regulierung als auch der ex-post-Haftung. So ist ein Bt-Mais anbauender Landwirt verpflichtet, Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der guten fachlichen Praxis einzuhalten. Weiterhin gilt im Falle eines Schadens die verschuldensunabhängige und gesamtschuldnerische Haftung.
Mögliche Kosten der ex-ante-Regulierung und ex-post-Haftung können durch Kooperation zwischen benachbarten Bt-Mais anbauenden und konventionell oder ökologisch wirtschaftenden Betrieben gesenkt werden. Dies kann beispielsweise durch eine Abstimmung der Anbaupläne erfolgen.
Da über die Anbauentscheidung von Bt-Mais in Deutschland und die damit verbundenen Kosten bislang wenig bekannt ist, wurden im Rahmen der vorliegenden Studie detaillierte Fallstudien angefertigt. Hierzu wurden acht Bt-Mais anbauende Landwirte sowie in drei Fällen auch jeweils zwei ihrer konventionell wirtschaftenden Flächennachbarn befragt. Als Untersuchungsregion wurde das Oderbruch im östlichen Teil des Landkreises Märkisch-Oderland im Bundesland Brandenburg ausgewählt, da hier einerseits der Maiszünsler als bedeutender Schädling auftritt und andererseits bereits seit einigen Jahren der Anbau von Bt-Mais stattfindet.
Die Kosten der Schadensvermeidung und Schadensersatzzahlung wurden von allen befragten Bt-Mais anbauenden Landwirten als gering bis nicht vorhanden eingestuft. In den untersuchten Großbetrieben (500 bis 3.000 Hektar) konnten die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände ohne Probleme umgesetzt und der Anbau von Bt-Mais in direkter Nähe zum Nachbarn umgangen werden.
Durch diese betriebsinterne Internalisierung der Kosten war eine Kooperation mit den Nachbarbetrieben zur Wahrung der Koexistenz bislang nicht notwendig.
Verbreitung von Bodenschadverdichtungen in Südniedersachsen
Von JOACHIM BRUNOTTE, Braunschweig, MARCO LORENZ, Berlin, CLAUS SOMMER, Braunschweig, TAMAS HARRACH, Gießen, und WALTER SCHÄFER, Bremen
Bodenschadverdichtung wirkt sich derart auf physikalische, chemische und biologische Vorgänge im Boden aus, dass Bodenfunktionen nachhaltig negativ beeinträchtigt werden. Die Literatur zu diesem Problembereich in der pflanzlichen Produktion ist umfangreich und widmet sich allen Facetten. Dagegen gibt es bisher nur wenige Untersuchungen zur flächenhaften Verbreitung von Bodenschadverdichtungen in Deutschland.
Hierzu Aussagen für Süd-Niedersachen zu machen, ist Zielsetzung dieses Beitrages. Dazu sollte mit Feld- und Laboruntersuchungen an jene von RUHM (1983) nach nunmehr 50 oder 20 Jahren angeknüpft werden. Zur Anzeige von Bodenschadverdichtung wurde das Indikatorsystem nach LEBERT et al. verwendet, welches sich auf die Bewertung von Bodenfunktionen und des Bodengefüges stützt; demnach ist nicht die Bodendichte (bzw. das Porenvolumen), sondern Schadensschwellen für die Kriterien Luftkapazität, gesättigte Wasserleitfähigkeit und Packungsdichte sind zur Kennzeichnung einer Schadverdichtung maßgebend, die alle drei erfüllt sein müssen.
An 47 Ackerstandorten in Südniedersachsen wurden insgesamt 4.440 Stechzylinderproben (100 cm3) in je zwei Profilgruben und in jeweils vier Tiefen mit je 15 (im Jahr 2002) und je zehn (im Jahr 2003) Wiederholungen entnommen. Bei den untersuchten Böden handelt es sich um Parabraunerden aus Löß. Die berücksichtigten Feldschläge lagen in Zuckerrüben-Getreide-Fruchtfolgen, da heutige Gesamtmassen der Zuckerrüben- und Getreideerntetechnik unter dem Aspekt Bodenschonung oftmals in der Kritik stehen. Im Labor wurden die Trockenrohdichte oder das Gesamtporenvolumen, die aktuelle Bodenfeuchte, die gesättigte Wasserleitfähigkeit, die Luftleitfähigkeit, die Porenverteilung und damit Luftkapazität, Feldkapazität, nutzbare Feldkapazität und permanenter Welkepunkt bestimmt.
Anhand der Ergebnisse der Laboruntersuchungen wurden acht Ackerschläge herausgefiltert, die bezüglich Luftkapazität und gesättigter Wasserleitfähigkeit kritische Werte nach dem Indikatorsystem aufwiesen und somit die Vermutung einer vorhandenen Schadverdichtung nahe legten. In den entsprechenden Profilgruben wurden dann im Jahr 2006 Bodengefügebeurteilungen durchgeführt und die Packungsdichte bestimmt.
Nach den vorgestellten Ergebnissen liegen in den Unterböden der untersuchten Produktionsflächen aktuell keine flächenhaften Schadverdichtungen vor. Zwar erfüllen zehn von insgesamt 47 Ackerschlägen die Kriterien Luftkapazität und gesättigte Wasserleitfähigkeit für Schadverdichtung, die Gefügebeurteilungen weisen jedoch Packungsdichten allesamt unter vier aus. Dennoch sollten im Sinne der Vorsorge alle Möglichkeiten für ein Boden schonendes Befahren genutzt werden.
Bereiche der Krumenbasis sind stellenweise nahe einer Schadverdichtung, in Fahrgassen und Vorgewenden wurden Schadverdichtungen festgestellt.
Aus den Ergebnissen wird der Vorschlag abgeleitet, einige der hier angesprochenen intensiv beprobten Ackerflächen in das Programm der Boden-Dauerbeobachtungsflächen des Landes Niedersachsen aufzunehmen. Damit wären weitere zeitliche Veränderungen des Bodengefüges, differenziert nach Unterboden und Krumenbasis in der Produktionsfläche sowie nach Vorgewenden zu dokumentieren. Schon mittelfristig wäre ein Frühwarnsystem gegen Bodenschadverdichtung etabliert.
Agrar- und Ernährungswirtschaft im Umbruch – Bericht über die 47. Jahrestagung der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaus und die 17. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Agrarökonomie 2007 an der Technischen Universität München
Von THILO GLEBE, ALOIS HEIßENHUBER, KLAUS SALHOFER, München – Weihenstephan, LEOPOLD KIRNER und SIEGFRIED PÖCHTRAGER, Wien
Vom 26. bis 28. September 2007 fanden gemeinsam die 47. Jahrestagung der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaus (GEWISOLA) und die 17. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft (ÖGA) an der Technischen Universität (TU) München in Freising-Weihenstephan statt. Das Thema der gemeinsamen Tagung lautete: "Agrar- und Ernährungswirtschaft im Umbruch". Vier Plenarvorträge, eine Podiumsdiskussion sowie 18 Arbeitsgruppensitzungen wurden abgehalten. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die möglichen Auswirkungen von Änderungen in der Agrar- und Ernährungswirtschaft auf Agrarpolitik und Agrarwissenschaften in der westlichen Welt sowie in Entwicklungsländern. Mehrere Arbeitsgruppensitzungen nahmen sich insbesondere den neuen Herausforderungen der Energiepolitik und dem damit verbundenen Spannungsfeld zwischen Ernährungssicherung und der energetischen Nutzung von Agrarrohstoffen an. Beiträge aus dem gesamten Spektrum der Agrar- und Ernährungsökonomie rundeten diese Tagung ab.
Der Markt für Zahlungsansprüche in Deutschland - eine deskriptive Analyse
Von NORBERT RÖDER und STEFAN KILIAN, Freising
Ein zentrales Element der Betriebsprämienreglung der Fischler-Reform ist die Einführung von entkoppelten Transferzahlungen in Form von Zahlungsansprüchen (ZA). Die deskriptive Analyse der Veränderung dieses Politikwechsels ist Gegenstand dieses Artikels. Auswertungen der Zentralen InVeKoS-Datenbank (ZID) zeigen, dass der gegenwärtige Wert und die Verteilung der Zahlungsansprüche weitestgehend die historischen landwirtschaftlichen Strukturen in Deutschland reflektieren. Während in den alten Bundesländern die Zahlungen zwischen intensiven und extensiven Regionen variieren, zeigt sich in den neuen Bundesländern eine homogenere Verteilung der Nennwerte. Bereits auf Ebene der Gemeinden ist in allen Handelsregionen eine große Heterogenität hinsichtlich der Nennwerte der ZA festzustellen. In Deutschland führt erst der Übergang zum Regionalmodell im Jahr 2013 zu einer deutlichen regionalen Umverteilung der landwirtschaftlichen Transferzahlungen der ersten Säule. Daneben ergeben die Auswertungen der ZID, dass Handel mit Zahlungsansprüchen per se, d. h. ohne den gleichzeitigen Handel von Flächen, kaum stattfindet. Die Auswertung einer Expertenbefragung ergab Handelspreise für ZA, die deutlich unter dem Barwert liegen. Dies kann unter anderem durch nicht aktivierte ZA begründet werden, die auf einen Überschuss an ZA hinweisen.
Bestimmungsgründe für die Aufgabe/Weiterführung landwirtschaftlicher Betriebe in Österreich
Von FRANZ WEIß, Wien
Im vorliegenden Beitrag wurde untersucht wie und wie stark betriebsspezifische Faktoren die Wahrscheinlichkeit einer Aufgabe landwirtschaftlicher Betriebe in Österreich im Zeitraum von 1995 bis 1999 beeinflusst haben. Als Datengrundlage dienten die einzelbetrieblichen Daten der Agrarstrukturerhebungen 1990, 1995 und 1999, die teilweise durch Daten aus dem INVEKOS-Datenbestand sowie Daten aus der regionalen Arbeitslosen- und Einkommensstatistik ergänzt wurden. Die Schätzungen wurden mit einem multivariaten logistischen Regressionsmodell durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass die Wahrscheinlichkeit einer Betriebsaufgabe insbesondere mit der Teilnahme am Umweltprogramm ÖPUL, dem Gesamteinkommen sowie der Höhe der Direktzahlungen (ÖPUL, Ausgleichszulage und Nationale Beihilfen) reduziert wird. Eine große Rolle spielt darüber hinaus das forstwirtschaftliche Einkommen, wobei der Besitz von kleinen bis mittelgroßen Waldflächen die Überlebenschance von Betrieben offenbar verbessert, während Betriebe mit großen Waldbesitzungen öfter aufgegeben werden. Neben den wirtschaftlichen Merkmalen spielen auch die familiären Verhältnisse und persönliche Eigenschaften des Betriebsleiters eine wichtige Rolle. So neigen kinderlose Betriebsleiter eher zur Aufgabe des Betriebes als solche mit Kindern, weibliche eher als männliche, und ältere eher als jüngere. Schließlich wurden auch regionale Faktoren getestet, wobei vor allem eine bessere Erreichbarkeit des nächstgelegenen überregionalen Zentrums die Ausstiegsneigung senkt.
Horizontale und vertikale Kooperation von Produzenten geschützter Herkunftsangaben – Die Verordnung (EG) Nr. 510/06 als Klammer für ein kooperatives Marketing
Von ADRIANO PROFETA und RICHARD BALLING, München
Einzelne Artikel der Verordnung (EG) Nr. 510/06 zum Schutze von Herkunftsangaben bei Agrarprodukten und Lebensmitteln zwingen die Produzenten zu einer überbetrieblichen Zusammenarbeit, während weitere Abschnitte der Verordnung den Produzenten die Option bieten, eine freiwillige Selbstverpflichtung in Bezug auf ein kooperatives Marketing einzugehen. Innerhalb dieses Aufsatzes wird nach einer kurzen Definition des Begriffes Kooperation analysiert, welche Möglichkeiten der zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 510/06 auf horizontaler und vertikaler Ebene für die Produzenten einer geschützten Herkunftsangabe bestehen. Darüber hinaus wird exemplarisch anhand von Praxisbeispielen dargestellt, wie ein kooperatives Marketing auf Basis der genannten Verordnung konkret ausgestaltet werden kann.