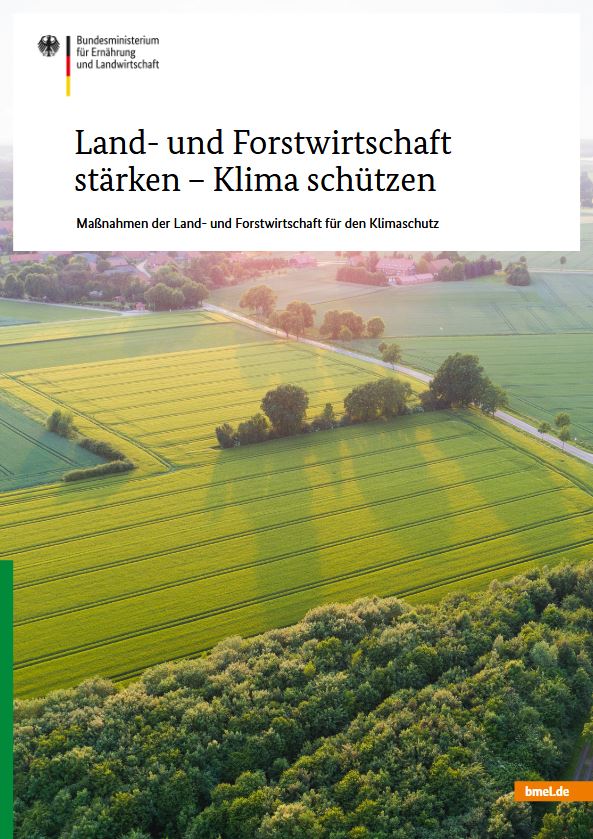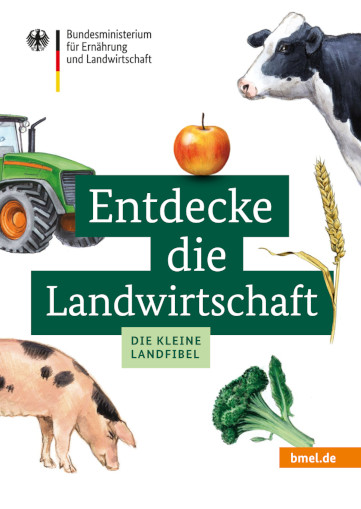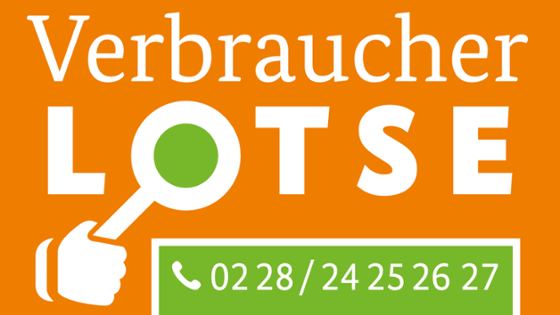Aus "Berichte über Landwirtschaft" - Heft 3, Dezember 2008, Band 86
Betrachtungen zum Saisonarbeitskräfteangebot in der deutschen Landwirtschaft
Von CARSTEN HOLST, SEBASTIAN HESS und STEPHAN VON CRAMON-TAUBADEL, Göttingen
Den jährlich nach Deutschland für begrenzte Zeit einreisenden mittel- und osteuropäischen Erntehelfern kommt eine große Bedeutung für besonders umsatzstarke Bereiche des deutschen Agrarsektors zu. Der Saisonarbeitsbedarf ist im Zeitraum von 1994 bis 2006 stark angestiegen, was überwiegend auf eine zunehmende Konzentration einzelner arbeitsintensiver Kulturen (Spargel und Erdbeeren) zurückzuführen ist, während das Arbeitsangebot mittel- und osteuropäischer Arbeitnehmer 2006 erstmals deutlich rückläufig war und seitdem deutsche Betriebe offenbar vor erhebliche Probleme stellt.
Mit der Beschränkung der Arbeitskräftemigration in diesem Sektor sollten inländische Arbeitsuchende verstärkt deren Tätigkeiten übernehmen (Eckpunkte-Regelung). Die Konzentration der anfallenden Saisonarbeit auf wenige Regionen Deutschlands führt jedoch in einigen Gebieten zu einer lokalen Unterversorgung mit inländischen Arbeitskräften. Der monetäre Anreiz für inländische Arbeitsuchende zur Aufnahme einer Beschäftigung ist im Vergleich zu den einreisenden mittel- und osteuropäischen Erntehelfern deutlich geringer. Deren Arbeitsangebot in Deutschland reduziert sich zudem, weil im Zuge der EU-Osterweiterung geänderte sozialversicherungsrechtliche Vorschriften gelten und auch in anderen Mitgliedstaaten mit liberalisierten Arbeitsmärkten Beschäftigungen angenommen werden können.
Die 2006 entstandene Angebotslücke im Bereich der landwirtschaftlichen Saisonarbeit erfordert Anpassungen für die Zukunft: Neben höheren Löhnen, die nicht nur zur Angebotsausdehnung, sondern auch zur Verbesserung der Arbeitsproduktivität dienen können, bietet die Bildung neuer Rechtsformen (Ltd. & Co. GbR) zur Beschäftigung mittel- und osteuropäischer Saisonarbeitnehmer eine Möglichkeit zur Umgehung der Eckpunkte-Regelung, während einer weiteren Mechanisierung sowie der Ausweitung informeller Beschäftigung enge Grenzen gesetzt sind.
Aktive Bürgerschaft in der ländlichen Entwicklung: Fünf Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern
Von LUTZ LASCHEWSKI, CLAUDIA NEU, Braunschweig, und THEODOR FOCK, Neubrandenburg
Partnerschaftliche Ansätze politischer Steuerung finden in der ländlichen Entwicklung aus unterschiedlichen Gründen einen zunehmenden Zuspruch. An die Zivilgesellschaft und an das bürgerschaftliche Engagement werden damit erhöhte Erwartungen gestellt. Für die neuen Bundesländer wurden allerdings in den letzen Jahren vielfach Zweifel hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der Zivilgesellschaft angemeldet. Faktisch steigen angesichts des Rückzugs des Wohlfahrtsstaates aber die Erwartungen an das bürgerschaftliche Engagement. In diesem Beitrag werden am Beispiel von fünf "aktiven" Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern Formen des bürgerschaftlichen Engagements beschrieben und ihre Leistungen und Grenzen diskutiert.
Die Ergebnisse zeigen, dass Netzwerke bürgerschaftlichen Engagements auch in den ländlichsten Regionen der neuen Bundesländer in weit stärkerem Maße existieren als bisher von Regionalforschung und Politik unterstellt wurde, und dass Entleerung und kulturelle Verödung kein unabwendbares Schicksal sind. Bürgerschaftliches Engagement verdient als wichtiger sozialer Entwicklungsfaktor gerade auch in den neuen Bundesländern mehr Beachtung. Infrastrukturentwicklung und bürgerschaftliches Engagement sind allerdings nicht unabhängig voneinander. Die zunehmende Regionalisierung der Infrastruktur erfordert eine Antwort darauf, wie diese Balance zwischen ökonomischer Effizienz und sozialer Integration hergestellt werden kann.
Ökonomisches Potenzial automatischer Lenksysteme
Von PATRICK ZIER, KLAUS HANK und PETER WAGNER, Halle
Die Entwicklung und Anwendung GPS-gestützter Lenksysteme in der Landwirtschaft ist auf eine Vielzahl von Potenzialen zurückzuführen. Einige Vorteile können zum Teil nur schwer oder gar nicht monetär bewertet werden. Ziel des vorliegenden Beitrages ist es, die ökonomischen Potenziale eines automatischen Lenksystems infolge geringerer Überlappungen und sichtunabhängiger Feldarbeit einzuschätzen.
Im Rahmen von Feldversuchen wurden die Überlappungen bei den relevanten Arbeitsgängen für den Marktfruchtbau ermittelt. Für die Durchführung der Versuche auf einem Mitteldeutschen Agrarunternehmen stand ein GreenStarTM AutoTrac-Lenksystem der Firma John Deere zur Verfügung. Die jährlichen Kosten dafür betragen 2.700 Euro.
Anhand eines entwickelten Modells für die ökonomische Bewertung automatischer Lenksysteme wird der Einfluss des Technikeinsatzes auf einen Modellbetrieb untersucht. Der Point of Break Even für die Investition in ein solches System kann somit unter verschiedenen Szenarien bestimmt werden. Wird das automatische Lenksystem zur Aussaat und Bodenbearbeitung eingesetzt, bedarf es einer Modellbetriebsfläche zwischen 283 und 303 ha. Bei einem ausschließlichen Einsatz zur Bodenbearbeitung liegt der Wert für Break Even zwischen 700 und 832 Hektar. Erfolgt der Technikeinsatz nur zur Aussaat ist eine Betriebsfläche von 476 Hektar für die Amortisation der Investition nötig.
Darüber hinaus wird der Effekt durch die Ausdehnung der Tagesarbeitszeit bei der Aussaat auf 24 Stunden untersucht. Bei einer Modellbetriebsgröße von 1.400 Hektar ist durch den Technikeinsatz die Einsparung einer Sämaschine möglich. Das Betriebsergebnis verbessert sich dadurch um 7.199 Euro pro Jahr.
Innovativer Dialog zur Entwicklung der multifunktionalen Landwirtschaft im Hochsauerlandkreis - Chancen erkennen…! und Chancen ergreifen…!
Von FRITZ HEMME, Meschede und HERMANN SCHLAGHECK, Swisttal
Welche Konsequenzen ergeben sich für die Entwicklung der multifunktionalen Landwirtschaft im Hochsauerlandkreis aus den grundlegenden Änderungen in der Agrarpolitik? Welcher Handlungsbedarf und welche Handlungsmöglichkeiten resultieren daraus auf der einzelbetrieblichen und der regionalen Ebene?
Diesen Fragen sind Fachleute der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen im Zusammenwirken mit Landwirten, Wissenschaftlern und Vertretern des Hochsauerlandkreises sowie weiterer Institutionen nachgegangen.
Das hier gewählte innovative Vorgehen, bei dem insbesondere landwirtschaftliche Unternehmer über Panel-Diskussionen eingebunden wurden, bietet sich auch für andere Regionen an.
Bei ähnlichen Projekten in anderen Regionen sollten neben den Hinweisen zur Panel-Methodik die Anmerkungen zu den Stichworten Kommunikation, Dialogstruktur, "Win-Win-Situationen", Prozesssteuerung, Arbeitsaufwand und Zukunftsrelevanz beachtet werden.
Milcherzeugung und Treibhausgas-Emissionen
Von WILFRIED BRADE, Hannover, ULRICH DÄMMGEN, PETER LEBZIEN und GERHARD FLACHOWSKY, Braunschweig
Die Notwendigkeit der Reduzierung der Emissionen von Treibhausgasen ist von weltweiter Bedeutung. Die weitere genetisch-züchterische Erhöhung des Milcheiweißgehaltes, bei gleichzeitiger Absenkung des Milchfettgehaltes, auf hohem Leistungsniveau (zum Beispiel 9.000 Kilogramm Milch pro Kuh pro Jahr) führt zu einem reduzierten Energieaufwand (für die Milchfetterzeugung) und einem erhöhten Futterproteinbedarf (für die Milcheiweißerzeugung) des Einzeltieres. Dies beeinflusst - bei konstant hohem Leistungsniveau - die Ausscheidungen (zum Beispiel N-Anfall, CH4-Emission) des Einzeltieres insgesamt nur verhältnismäßig gering. Bezogen auf das produzierte Milcheiweiß wird der Aufwand jedoch geringer und der positive Effekt auf die Umwelt deutlicher.
Unter Berücksichtigung der berechneten Methan- oder auch N-Ausscheidungen sollte ein hohes Niveau tierischer Leistungen (unter gezielter Beachtung eines hohen Milcheiweißgehaltes) und eine dadurch mögliche Reduzierung der Zahl erforderlicher Milchkühe die (gegenwärtig) effektivste Maßnahme sein, eine verminderte Methanemission zu erzielen.
Zusätzlich ist der Einfluss der Nutzungsdauer der Kühe auf die CH4-Emissionen kalkuliert worden. Eine längere Nutzungsdauer der Kühe lässt gleichfalls die CH4-Emissionen pro kg erzeugte Milch reduzieren.
Schlüsselwörter: Milch, Methan-Emission, Treibhauspotenzial, Ressourcenschonung, Rinderzüchtung
Die raum-zeitliche Dynamik in der US-amerikanischen Rindfleischproduktion
Von HANS-WILHELM WINDHORST, Vechta
Die Rindfleischproduktion ist der wichtigste Zweig der US-amerikanischen Agrarwirtschaft und von großer gesamtwirtschaftlicher Bedeutung. In diesem Beitrag wird zunächst die Entwicklung von der extensiven Weidewirtschaft in den Grasländern der Great Plains zur Intensivmast in feedlots nachgezeichnet. Danach wird aufgezeigt, dass mit dem sektoralen Konzentrationsprozess, also der zunehmenden Verringerung der Anzahl der Mastbetriebe, ein regionaler Verlagerungsprozess aus dem Mittelwesten in die mittlern und südlichen Plainsstaaten verbunden war. Dort entstanden auf der Grundlage des Bewässerungsfeldbaus große Mastanlagen, die heute den Mastsektor dominieren. Die Schlacht- und Verarbeitungsbetriebe folgten den Mastbetrieben innerhalb weniger Jahrzehnte. Dabei bildete sich eine Organisationsstruktur aus, die die extensive Weidehaltung, die Intensivmast und die Schlachtung, Verarbeitung und Vermarktung einbindet, ohne allerdings zu geschlossenen Produktionssystemen wie in der Schweine- oder Geflügelfleischproduktion zu gelangen.
Die stetige Ausweitung der Rindfleischproduktion hat die USA zu einem der wichtigsten Exportländer von Rindfleisch werden lassen, dennoch werden weiterhin wegen des hohen Pro-Kopf-Verbrauches pro Jahr etwa eine Million Tonnen eingeführt. Sehr enge Handelsbeziehungen bestehen zwischen den drei NAFTA-Staaten. Weitreichenden Einfluss auf die zukünftige Entwicklung der Rindfleischproduktion in den USA werden die Ausweitung der Bioenergieproduktion und eine verschärfte Umweltgesetzgebung haben. Beide werden eine Erhöhung der Produktionskosten zur Folge haben. Ob die erwartete Erhöhung der Futterkosten eine Rückverlagerung in den ehemaligen corn belt auslösen wird, ist eine noch offene Frage.
Stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen
Von KLAUS MENRAD, CHRISTIANE JOIKO, THOMAS DECKER, ANDREAS GABRIEL, und BETTINA SCHMIDT, Straubing
In dem Beitrag wird ein Überblick über die ökonomische Relevanz und die Marktrelevanz der verschiedenen Produktgruppen der stofflichen Nutzung aus nachwachsenden Rohstoffen gegeben. Der Marktanteil nachwachsender Rohstoffe innerhalb der untersuchten Anwendungsbereiche der stofflichen Nutzung ist in den meisten Fällen noch verhältnismäßig gering. Meist sind die Produkte teurer als fossile Erzeugnisse. Außerdem haben potenzielle Nutzer über alle Anwendungsfelder hinweg erhebliche Informationsdefizite hinsichtlich der Qualität oder der Produkteigenschaften von Erzeugnissen aus nachwachsenden Rohstoffen. Die besten kurzfristigen Marktchancen ergeben sich bei der Fokussierung auf Nischen, in denen die individuellen Qualitätsvorteile der jeweiligen Produkte zum Tragen kommen. Parallel dazu muss auf verstärktes, innerhalb der Anwendungsfelder abgestimmtes und zielorientiertes Marketing gesetzt werden. Vor allem den Akteuren mit Flaschenhalsfunktion (zum Beispiel Architekten, Handwerker, Berater) müssen die Eigenschaften/Vorteile der verschiedenen Produkte vermittelt werden, damit diese wiederum die (End-) Kunden von den Vorzügen der Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen überzeugen können.
Die Öko-Zertifizierung in Deutschland aus Sicht der Produzenten: Handlungsvorschläge zur politischen Weiterentwicklung
Von HOLGER SCHULZE, GABRIELE JAHN, JOCHEN NEUENDORFF und ACHIM SPILLER, Göttingen
Um den veränderten Anforderungen des ökologischen Marktes gerecht zu werden (zum Beispiel zunehmende Internationalisierung), hat sich der Agrarrat im vergangenen Jahr (28. Juni 2007) auf eine neue Verordnung zur Produktion und Kennzeichnung von ökologischen Produkten verständigt (VO (EG) Nr. 834/2007). Die Öko-Kontrolle soll zukünftig europaweit durch staatliche Behörden durchgeführt werden, die nur "genau beschriebene Aufgaben" an private Öko-Kontrollstellen übertragen dürfen. Insgesamt kann die Neuregelung als deutlicher Schritt zu einem vermehrt staatlichen und formalen Kontrollsystem betrachtet werden. Dieser institutionelle Wechsel bildet die Ausgangsbasis dieses Beitrages, der auf eine Befragung von 126 deutschen Öko-Landwirten beruht.
Im Mittelpunkt der empirischen Untersuchung stehen dabei zwei Hauptfragen: Zum einen wird die Wahrnehmung der Verlässlichkeit des Kontrollsystems aus Sicht der Landwirte untersucht. Zum anderen werden die potenziellen politischen Entwicklungsoptionen der Öko-Kontrolle betrachtet. Die zweite Fragestellung ist insbesondere deshalb wichtig, da im Anschluss an die neue EU-Öko-Verordnung noch keine nationalen Durchführungsgesetze und -verordnungen verabschiedet wurden, so dass hier noch politischer Gestaltungsspielraum besteht.
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass der größte Teil der Landwirte mit dem aktuellen Zertifizierungssystem zufrieden ist. Allerdings kritisieren sie die steigenden bürokratischen Kosten und den geringen betrieblichen Nutzen des Systems. Bezüglich der Wahrnehmung der Verlässlichkeit des Systems geben die Probanden zwar an, dass sie mit den Prüfern während des Zertifizierungsprozesses sehr zufrieden sind, dennoch hat über ein Drittel der Landwirte Bedenken, dass es in Zukunft immer mehr "Schwarze Schafe" in der Bio-Branche geben wird. Bei der zweiten Hauptfrage zur zukünftigen Orientierung der EU-Zertifizierung geben die Landwirte kein eindeutiges Urteil ab. Zwar meinen fast alle Befragten, dass die Kontrolle nicht vom Staat übernommen werden sollte. Andererseits sehen sie diese Aufgabe aber auch nicht wieder bei den Verbänden oder bei Berufskollegen. Stattdessen präferieren sie eine beratungsorientierte Qualitätssicherung im Öko-Landbau.
Aus politischer Sicht sollte daher der Fortführung und Weiterentwicklung des bestehenden Öko-Kontrollsystems in Form von privatwirtschaftlich organisierten Öko-Kontrollstellen unter staatlicher Aufsicht der Vorzug gegeben werden. Diese Entwicklung sollte dabei durch einen Ausbau der Beratung und eine verstärkte Risikoorientierung während der Inspektionen erfolgen.
"Agri-Food Business: Global Challenges – Innovative Solutions"
Ergebnisse des IAMO-Forums 2008 in Halle vom 25. bis 27. Juni 2008
Von THOMAS GLAUBEN, JON HANF, MICHAEL KOPSIDIS, AGATA PIENIADZ und KLAUS REINSBERG, Halle (Saale)
Der Beitrag enthält die wichtigsten Ergebnisse des IAMO Forum 2008 "Agri-Food Business: Global Challenges – Innovative Solutions", das vom 25. bis 27. Juni in Halle (Saale) stattfand. 171 Teilnehmer aus mehr als 20 Ländern diskutierten wichtige globale Entwicklungen im Agri-Food-Sektor sowie in seinem ökonomischen und politischen Umfeld. Kernthemen waren Lebensmittelqualität und Nahrungssicherheit, Bioenergie und Deregulierung. Ausgewiesene Wissenschaftler und Führungskräfte internationaler Organisationen wie der FAO und der EU hielten sechs Plenarvorträge. In elf Sektionen und zwei Postersitzungen wurden mehr als 35 Papiere und 40 Poster vorgestellt und diskutiert, die einen tiefen Einblick in die aktuelle Forschung boten.