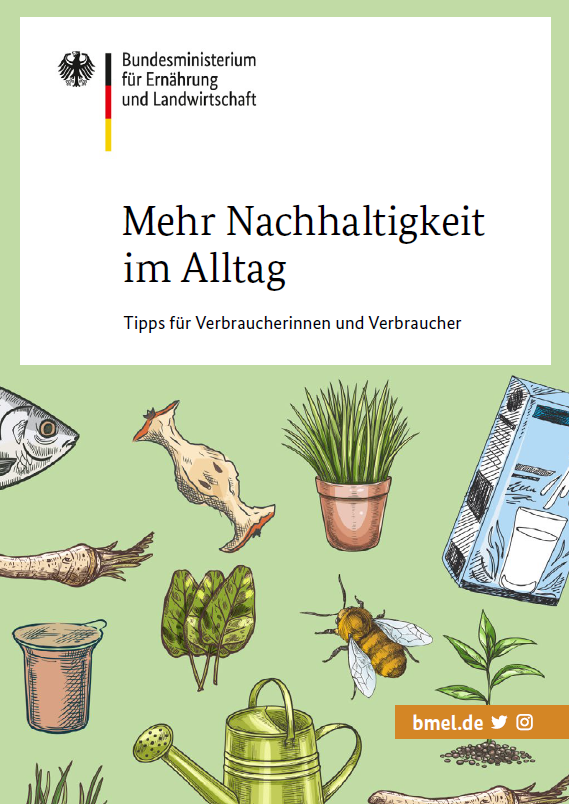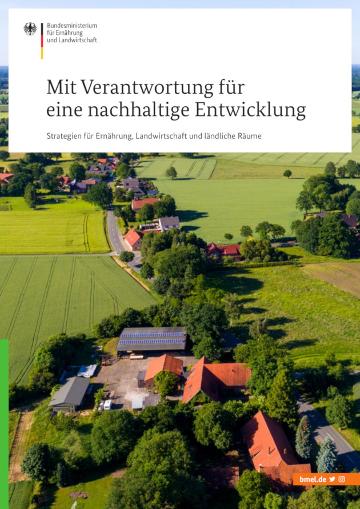Das Menschenrecht auf Nahrung verwirklichen - die wichtigsten politischen Meilensteine
Bereits 1948 fand das Recht auf Nahrung Eingang in die Allgemeine Erklärung zu Menschenrechten der Vereinten Nationen (VN). Völkerrechtlich verankert wurde es 1976 mit Inkrafttreten des UN-Sozialpakts, den inzwischen 164 Staaten (Stand: Juli 2019) unterzeichnet haben.
Gemäß Artikel 11 des Pakts erkennen die Vertragsstaaten das Recht eines jeden auf ausreichende Ernährung, einen angemessenen Lebensstandard sowie den Schutz vor Hunger an. Der Sozialpakt ist ein internationaler Vertrag, dessen Einhaltung der UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (CESCR) überwacht. Er fordert in fünfjährigen Abständen Berichte aller Unterzeichnerstaaten ein und beurteilt auf dieser Grundlage die Menschenrechtslage. Der Ausschuss kann jedoch keinerlei Sanktionen verhängen, sondern nur Empfehlungen aussprechen.
Auf internationaler Ebene sind in den vergangenen Jahrzehnten eine Reihe von Vereinbarungen getroffen worden, die einen Beitrag zur gemeinsamen Verwirklichung des Rechts auf Nahrung leisten sollen. Ein zentraler Bezugspunkt dieser globalen Rahmensetzung ist die Erklärung von Rom aus dem Jahre 1996.
Der erste Welternährungsgipfel - Die Erklärung von Rom
Am ersten Welternährungsgipfel in Rom 1996 nahmen hochrangige Vertreter von 185 Staaten teil. In der Erklärung von Rom bekräftigten sie "das Recht jedes Menschen auf Zugang zu gesundheitlich unbedenklichen und nährstoffreichen Nahrungsmitteln in Einklang mit dem Recht auf angemessene Ernährung und dem grundlegenden Recht eines jeden Menschen, frei von Hunger zu sein". Zudem wurde in Rom ein Aktionsplan beschlossen, der die Staaten auffordert, Ernährungssicherung und Armutsbekämpfung Priorität einzuräumen.
Der zweite Welternährungsgipfel
In der Erklärung zum zweiten Welternährungsgipfel 2002 riefen die dort versammelten Staats- und Regierungschefs zur Einrichtung einer zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe auf, deren Aufgabe es sein sollte, "innerhalb von zwei Jahren unter Beteiligung der Akteure einen Katalog Freiwilliger Leitlinien zu erstellen, um die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zu unterstützen, das Recht auf angemessene Nahrung im Rahmen der nationalen Ernährungssicherheit schrittweise zu realisieren."
Die Freiwilligen Leitlinien der FAO zum Recht auf Nahrung
Die daraufhin im November 2004 von der FAO beschlossenen "Freiwilligen Richtlinien zur Implementierung des Rechts auf Nahrung" fordern von den Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen erneut, ihre Anstrengungen zur Bekämpfung des Hungers zu verstärken. An der Entwicklung dieser freiwilligen Leitlinien war Deutschland, insbesondere durch die intensive Unterstützung der zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), federführend beteiligt. Die Freiwilligen Leitlinien zielen darauf ab, "den Staaten bei der Umsetzung der schrittweisen Verwirklichung des Rechtes auf angemessene Nahrung im Rahmen der nationalen Ernährungssicherheit praktische Hilfestellung zu leisten, um die Ziele des Aktionsplans des Welternährungsgipfels zu erreichen".
Mit den Leitlinien wurden die Bemühungen für eine umfassende weltweite Bekämpfung von Hunger und Unterernährung im Rahmen der Vereinten Nationen gestärkt. Die Staatengemeinschaft hat mit ihnen zum ersten Mal Verpflichtungen aus den im Sozialpakt niedergelegten Rechten konkretisiert und gleichzeitig Legislative, Justiz, Medien und Zivilgesellschaft im Kampf gegen Hunger und Unterernährung eine wichtige Berufungsgrundlage für mehr innerstaatliche Verantwortung und gute Regierungsführung an die Hand gegeben.
Der dritte Welternährungsgipfel – Die Globale Partnerschaft für Landwirtschaft und Ernährungssicherheit
Mit dem Ziel, den Startschuss für eine neue Struktur der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Sicherung der Welternährung zu geben, wurden auf dem dritten Welternährungsgipfel 2009 - in Anknüpfung an die Beschlüsse der G8 auf dem Gipfel von L’Aquila sowie des G20-Gipfels von Pittsburgh - die Grundlagen für die Etablierung einer Globalen Partnerschaft für Landwirtschaft und Ernährungssicherheit (Global Partnership for Agriculture and Food Security) gelegt. Sie strebt eine stärkere Koordinierung und Kohärenz der Maßnahmen zur Sicherung der Welternährung an und etabliert zu diesem Zweck ein Netzwerk zwischen den für Landwirtschaft und Ernährung zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen sowie Geberländern, Entwicklungsländern, Nichtregierungsorganisationen und der Wirtschaft.
Die Freiwilligen Leitlinien zu Landnutzungsrechten
Die 2012 vom Ausschuss für Welternährungssicherung der Vereinten Nationen (CFS) beschlossenen "Freiwilligen Leitlinien für die verantwortungsvolle Verwaltung von Boden- und Landnutzungsrechten, Fischgründen und Wäldern" sind das erste globale völkerrechtliche Instrument, das den sicheren und gerechten Zugang zu natürlichen Ressourcen regelt und sich dabei auch mit der Gestaltung von Landinvestitionen – dem so genannten "Landgrabbing" – befasst. Ziel ist es, die Menschen in Entwicklungsländern gezielt zu stärken, damit sie aus eigener Kraft ihre Existenz sichern können.
Die Freiwilligen Leitlinien skizzieren, wie Landtransfer-Prozesse unter Achtung des Menschenrechts auf Nahrung sowie der Eigentums- und Nutzungsrechte der lokalen Bevölkerung auszugestalten sind.
Sowohl Investoren und Regierungen in den betroffenen Staaten als auch Geberländer und Nichtregierungsorganisationen werden sich auch in Zukunft an den Freiwilligen Leitlinien messen lassen müssen. Ihre Einhaltung muss eine ständige Bedingung für die bilaterale Zusammenarbeit mit Partnerländern sein und auch von internationalen Geberinstitutionen berücksichtigt werden.
Die Prinzipien für verantwortliche Investitionen in die Landwirtschaft und Nahrungsmittelsysteme
Im Oktober 2014 verabschiedete der Welternährungsausschuss zudem Prinzipien für verantwortliche Investitionen in die Landwirtschaft und Nahrungsmittelsysteme. Sie sind das Ergebnis eines mehrjährigen Konsultations- und Verhandlungsprozesses der Staaten mit weit-reichender Beteiligung der Wirtschaft wie auch der Zivilgesellschaft.
Um die Ernährungssituation nachhaltig zu verbessern sind in vielen Teilen der Welt öffentliche und private Investitionen in den Agrarsektor und die gesamte Wertschöpfungskette dringend erforderlich. Das Ziel der so genannten RAI Principles (Principles for Responsible Investment in Agriculture and Food Systems) ist es, diese Investitionen so zu gestalten, dass sie der Bevölkerung in den Entwicklungs- und Schwellenländern zugutekommen.
Die Nachhaltigkeitsziele – SDG 2030
Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung sind politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen, die der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene dienen sollen. Die Ziele wurden in Anlehnung an den Entwicklungsprozess der Millenniums-Entwicklungsziele (MDGs) entworfen und traten am 1. Januar 2016 mit einer Laufzeit von 15 Jahren (bis 2030) in Kraft.
Mit dem SDG 2 soll erreicht werden, dass alle Menschen bis 2030 Zugang zu gesunder und ausreichender Nahrung haben und die Nachhaltigkeit in der Nahrungsmittelproduktion sichergestellt ist.
Das BMEL arbeitet - gemeinsam mit der FAO - mit Nachdruck an der Umsetzung dieses Zieles.