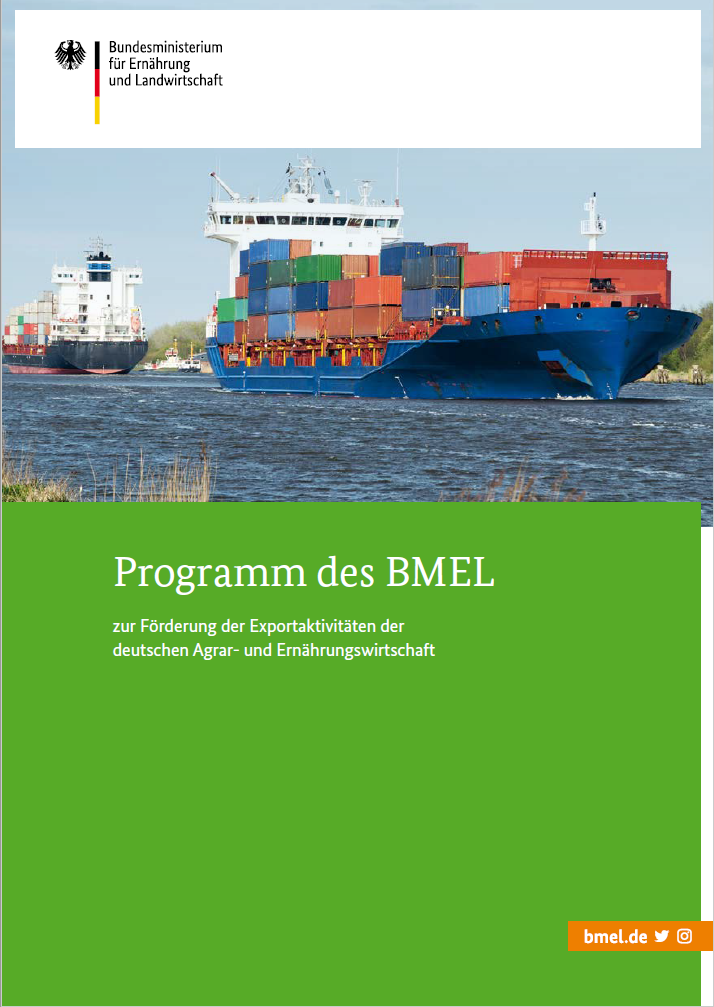Schutz vor unlauteren Handelspraktiken
Gesetzliche Regeln stärken die Verhandlungsposition von Landwirten gegenüber umsatzstarken Unternehmen in der Lebensmittellieferkette
Die Bezahlung für die ausgelieferten 30 Paletten Salatköpfe lässt auf sich warten, der Auftrag, weitere 20 Paletten anzuliefern, wird über Nacht storniert. Unlautere Handelspraktiken wie diese sind nicht zulässig.
Landwirtinnen und Landwirte sollen auskömmlich wirtschaften können und für ihre Leistungen anständig bezahlt werden. In ihrer Rolle als kleinere Marktteilnehmer haben Landwirte aber in der Regel eine geringere Verhandlungsmacht als die Unternehmen der vielfach hochkonzentrierten Stufen der Verarbeitung und des Lebensmitteleinzelhandels. Alternative Absatzwege sind meist nicht gegeben, auch aufgrund der schnellen Verderblichkeit vieler landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Durch das Machtungleichgewicht in der Lebensmittelkette zu Ungunsten der Landwirte hatten sich in der Vergangenheit Praktiken etabliert, die Erzeuger benachteiligen. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) setzt sich deshalb dafür ein, die Stellung der landwirtschaftlichen Erzeugerinnen und Erzeuger in der Wertschöpfungskette zu stärken.
Das Gesetz zur Stärkung der Organisationen und Lieferketten im Agrarbereich (Agrar-Organisationen-und-Lieferketten-Gesetz – kurz: AgrarOLkG) verbietet unlautere Handelspraktiken und sorgt so für mehr Fairness bei den Geschäftsbeziehungen in der Lebensmittellieferkette. Das Gesetz ist am 9. Juni 2021 in Kraft getreten. Am 8. Juni 2022 lief die einjährige Übergangsfrist zur Anpassung von Altverträgen an die neuen Regelungen ab. Einzelne Vorschriften des AgrarOLkG werden in der Verordnung zur Stärkung der Organisationen und Lieferketten im Agrarbereich (Agrarorganisationen-und-Lieferketten-Verordnung – kurz: AgrarOLkV) präzisiert.
Zwei Jahre nach seinem Inkrafttreten wurde das AgrarOLkG im Jahr 2023, wie gesetzlich vorgeschrieben, durch das BMEL evaluiert und die Wirksamkeit seiner Regelungen überprüft. Hierfür wurden Befragungen der Wirtschaftsbeteiligten durchgeführt sowie das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) einbezogen. Die Ergebnisse des Evaluierungsberichts belegten die grundsätzliche Wirksamkeit der mit dem AgrarOLkG getroffenen Regelungen. Die Verbote unlauterer Handelspraktiken zeigten erste Wirkung und die Verhandlungsposition der Lieferanten wurde gestärkt. Zugleich wurde offensichtlich, dass Anpassungen im AgrarOLkG nötig sind, um die Fairness in der Wertschöpfungskette weiter zu stärken.
In der Folge wurde das AgrarOLkG im Rahmen des sog. Agrarpakets der Regierungskoalition mit Wirkung zum 31. Oktober 2024 geändert. Durch das Gesetz zur Änderung agrarrechtlicher Vorschriften wurden insbesondere Ausweichbewegungen, mit denen verbotene Handelspraktiken umgangen werden sollen, verboten. Einzelne Verbote unlauterer Handelspraktiken wurden tatbestandlich eingegrenzt, um überschießende Tendenzen zu vermeiden. Mit Blick auf den Anwendungsbereich des AgrarOLkG hatte die Evaluierung zudem gezeigt, dass sich der Schutz vor unlauteren Handelspraktiken bei Lieferanten bestimmter Produktgruppen wie Milch, Obst und Gemüse mit Umsatzgrößen bis 4 Milliarden Euro besonders bewährt hatte. Daher wurde die bisherige zeitliche Befristung aufgehoben, so dass diese Lieferanten nun dauerhaft geschützt werden. Der Schutz gilt bis zu einem globalen Jahresumsatz von 15 Milliarden Euro. Nach Ablauf von drei Jahren nach Inkrafttreten der Änderungen sind diese zu evaluieren.
Welche Praktiken sind verboten?
Das Gesetz zur Stärkung der Organisationen und Lieferketten im Agrarbereich sieht ein Verbot der schädlichsten unlauteren Handelspraktiken in der Lebensmittelkette vor. Es enthält generelle Verbote für bestimmte unlautere Handelspraktiken. Diese Praktiken gehören zur "schwarzen Liste". Andere Praktiken sind dann verboten, wenn sie nicht zuvor klar und eindeutig zwischen den Vertragsparteien vereinbart wurden. Diese Praktiken zählen zur „grauen Liste“.
Diese Praktiken sind generell verboten:
Kaufpreiszahlungen
- für verderbliche Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse später als 30 Tage nach der Lieferung oder – wenn die Erzeugnisse regelmäßig geliefert werden – nach Ablauf des vereinbarten Lieferzeitraums oder später als 30 Tage nach dem Tag der Festlegung des zu zahlenden Betrags und
- bei anderen als verderblichen Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen später als 60 Tage nach der Lieferung oder – wenn die Erzeugnisse regelmäßig geliefert werden – nach Ablauf des vereinbarten Lieferzeitraums oder später als 60 Tage nach dem Tag der Festlegung des zu zahlenden Betrags;
- Zurückschicken unverkaufter Erzeugnisse vom Käufer an den Lieferanten
- ohne Zahlung des Kaufpreises und
- ohne Zahlung der Beseitigungskosten, soweit die Erzeugnisse nicht mehr verwendbar sind,
- ausgenommen sind Erzeugnisse, die mindestens 12 Monate weiter zum Verkauf geeignet sind;
- kurzfristige Stornierung von Bestellungen verderblicher Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse durch den Käufer;
- Abwälzung der Lagerkosten des Käufers auf den Lieferanten (gilt nicht gegenüber Käufern, die Zusammenschlüsse von Lieferanten zur gemeinsamen Nutzung von Lagereinrichtungen sind);
- einseitige Änderung der Bedingungen einer Lieferung in Bezug auf Häufigkeit, Art und Weise, Ort, Zeitpunkt oder Umfang der Lieferung, der Qualitätsstandards, der Zahlungsbedingungen oder der Preise oder bestimmter Dienstleistungen durch den Käufer;
- Zahlungsverlangen des Käufers für Qualitätsminderung oder vollständige Qualitätseinbuße von Erzeugnissen nach Übergabe der Lieferung an den Käufer; oder für die Bearbeitung von Kundenbeschwerden im Zusammenhang mit den Erzeugnissen des Lieferanten; ohne dass ein Verschulden des Lieferanten vorliegt;
- Forderung von Zahlungen, die nicht im Zusammenhang mit dem Verkauf von Erzeugnissen des Lieferanten stehen;
- Zahlungsverlangen des Käufers für die Listung markteingeführter Produkte;
- Drohung des Käufers mit Vergeltungsmaßnahmen geschäftlicher Art oder deren Anwendung, wenn der Lieferant von seinem vertraglichen oder gesetzlichen Rechten Gebrauch macht oder seine gesetzlichen Pflichten erfüllt;
- Weigerung des Käufers, eine geschlossene Liefervereinbarung oder bestimmte Zahlungen- und Kostenschätzungen auf Verlangen des Lieferanten in Textform zu bestätigen;
- Rechtswidrige Erlangung, Nutzung oder Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen des Lieferanten durch den Käufer;
Was ist das sog. Umgehungsverbot?
Als neue verbotene Handelspraxis gilt seit dem 31. Oktober 2024 ein sog. Umgehungsverbot, wenn Vertragsbedingungen eine Umgehung der generellen Verbote (gemäß § 23 Satz 2 Buchstaben a bis e und g AgrarOLkG) bewirken. Zusätzlich zu diesen Verboten verbietet das in § 23 Satz 2 Buchstabe h AgrarOLkG geregelte Umgehungsverbot somit Ausweichbewegungen des Marktes zu den bisher verbotenen Praktiken.
Diese Praktiken sind verboten, wenn sie nicht zuvor klar und eindeutig vereinbart worden sind
- Rücknahmeverlangen nicht verkaufter Erzeugnisse des Käufers ohne Kaufpreiszahlung bei Erzeugnissen, die mindestens 12 Monate weiter zum Verkauf geeignet sind,
- Zahlungsverlangen des Käufers für die Lagerung der Erzeugnisse, wenn der Käufer ein Zusammenschluss von Lieferanten zur gemeinsamen Nutzung von Lagereinrichtungen ist;
- Zahlungsverlangen des Käufers für die Listung der Erzeugnisse bei deren Markteinführung,
- Zahlungsverlangen des Käufers für die Vermarktung der gelieferten Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen, einschließlich Verkaufsangeboten, der Werbung, Preisnachlässen im Rahmen von Verkaufsaktionen und der Bereitstellung auf dem Markt;
- Zahlungsverlangen des Käufers für das Einrichten der Verkaufsräumlichkeiten.
Wer wird geschützt?
Die Regeln schützen alle Unternehmen der Lebensmittelerzeugung und -verarbeitung bis zu einem Jahresumsatz von 350 Millionen Euro gegenüber jeweils größeren Unternehmen der Lebensmittelverarbeitung beziehungsweise des Lebensmittelhandels.
Zudem werden Lieferanten von Milch- und Fleischprodukten sowie von Obst-, Gemüse- und Gartenbauprodukten einschließlich Kartoffeln geschützt, die einen Jahresumsatz im jeweiligen Verkaufssegment in Deutschland von höchstens vier Milliarden Euro haben. Allerdings darf ihr gesamter Jahresumsatz nicht mehr als 20 Prozent des globalen Jahresumsatzes des Käufers betragen. So werden unter anderem auch größere erzeugergetragene Unternehmen aus den genannten Sektoren in den Anwendungsbereich einbezogen. Bislang waren diese Lieferanten nur befristetet vom Schutzbereich des AgrarOLkG erfasst, durch das Gesetz zur Änderung agrarrechtlicher Vorschriften werden diese Lieferanten ab dem 31. Oktober 2024 nun dauerhaft geschützt werden. Der Schutz gilt bis zu einem globalen Jahresumsatz von 15 Milliarden Euro. Lieferanten, deren globaler Jahresumsatz darüber liegt, fallen dann nicht in den Anwendungsbereich.
Durch den Schutz sowohl der Erzeuger als auch größerer Lieferanten wird vermieden, dass über unlautere Handelspraktiken an anderen Stellen der Kette ein zu starker Druck auf Landwirte ausgeübt wird.
Lieferanten, die von unlauteren Handelspraktiken betroffen sind, können eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) erheben. Sie agiert als Durchsetzungsbehörde für die Regelungen und kann auch von Amts wegen Untersuchungen einleiten. Es können Geldbußen bis zu 750 000 Euro verhängt werden.
EU-weiter Schutz
Das Gesetz zur Stärkung der Organisationen und Lieferketten im Agrarbereich dient der Umsetzung der so genannten UTP-Richtlinie. Die Richtlinie (EU) 2019/633 über unlautere Handelspraktiken in den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen in der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette - kurz: UTP-Richtlinie - wurde im April 2019 vom Europäischen Parlament und dem Rat der Europäischen Union erlassen.
Mit der Umsetzung der Richtlinie durch die Mitgliedstaaten in nationales Recht gilt erstmals EU-weit ein einheitlicher Mindestschutzstandard und Erzeugerinnen und Erzeuger landwirtschaftlicher Produkte werden gestärkt.
Deutschland geht bei der Richtlinienumsetzung punktuell über den EU-weiten Mindestschutz hinaus. Das Gesetz zur Stärkung der Organisationen und Lieferketten im Agrarbereich verbietet drei weitere Praktiken, die nach der UTP-Richtlinie als Teil der sog. grauen Liste bei vorangehender klarer und eindeutiger Vereinbarung zulässig wären. Zusätzlich verboten wird die Rückgabe unverkaufter Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse vom Käufer an den Lieferanten ohne Zahlung des Kaufpreises (sog. Retourenverbot; betrifft nicht Erzeugnisse, die mindestens 12 Monate weiter zum Verkauf geeignet sind. Für sie bleibt es beim sog. grauen Verbot). Verboten ist außerdem, Listungskosten für markteingeführte Produkte sowie Lagerkosten des Käufers auf den Lieferanten abzuwälzen (betrifft nicht Käufer als Zusammenschlüsse von Lieferanten zur gemeinsamen Nutzung von Lagereinrichtungen; für sie bleibt es beim sog. grauen Verbot). Eine einseitige Risikoverteilung zulasten der Erzeuger ist dadurch nicht mehr möglich. Auch mit der nunmehr unbefristeten Ausdehnung des Kreises der geschützten Lieferanten geht Deutschland über die Mindestvorgabe der UTP-Richtlinie hinaus. Während nach der Richtlinie Lieferanten mit einem Jahresumsatz bis 350 Millionen Euro geschützt werden müssen, werden in Deutschland für bestimmte Sektoren Lieferanten bis zu einem Jahresumsatz im jeweiligen Verkaufssegments von höchstens vier Milliarden Euro in den Schutz einbezogen. Zudem darf der globale Jahresumsatz des Lieferanten nicht mehr als 15 Milliarden Euro und nicht mehr als 20 Prozent des globalen Jahresumsatzes des Käufers betragen.