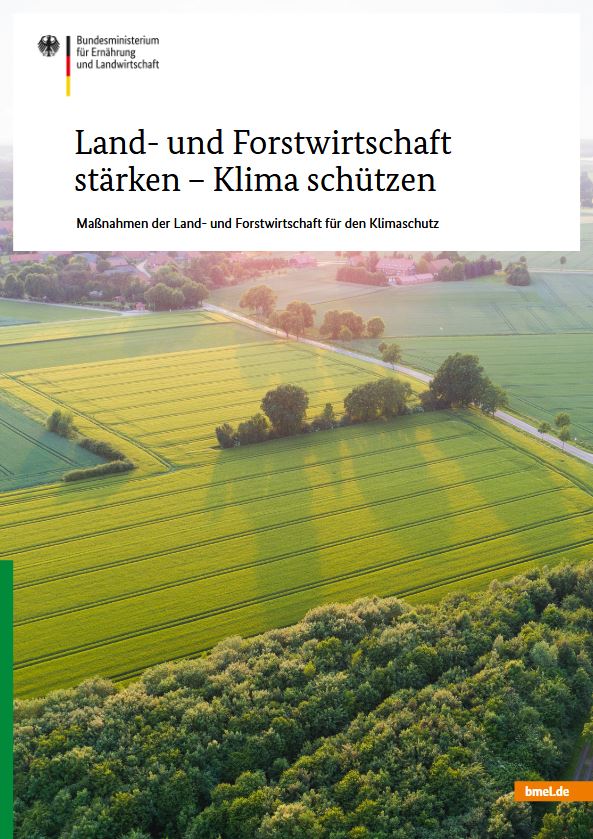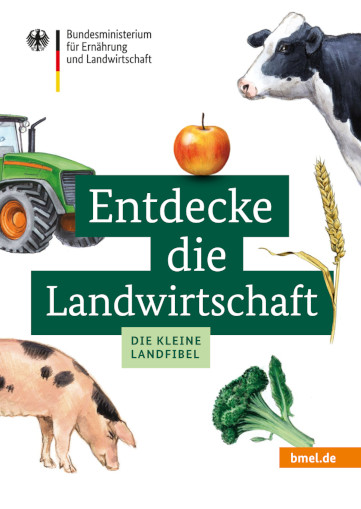Der Wolf: Zwischen Schutz und Herausforderung
Der Wolf ist nach Deutschland zurückgekehrt. Nach letzten Daten lebten im Monitoringjahr 2023/2024 in Deutschland circa 209 Rudel, 46 Wolfspaare und 19 territoriale Einzeltiere.
Der Artenschutz des Wolfs fordert insbesondere die Weidetierhalter, aber auch andere Bereiche, wie die Jagd oder den Tourismus heraus. Zudem führt er zu einer übergreifenden öffentlichen Diskussion und löst insbesondere im ländlichen Raum Sorgen aus.
Der Wolf verbreitet sich inzwischen flächendeckend in Deutschland. Durch die vermehrte Ausbreitung nehmen Wolfsrisse zu. Besonders gefährdet sind ungeschützte Weidetiere. Die Anzahl von verwundeten und getöteten Tiere ist von 40 Tieren im Jahr 2006 auf rund 5.727 Tiere bei 1.268 Übergriffen im Jahr 2023 angestiegen. Ein Großteil der Wolfübergriffe erfolgte auf Schafe und Ziegen. Die Ausgaben für Herdenschutzmaßnahmen in Deutschland beliefen sich 2023 auf rund 18,5 Mio. Euro. Die Ausgleichzahlungen für Nutztierübergriffe beliefen sich 2022 auf rund 637.000 Euro.
Auch andere Gruppen, zum Beispiel Jäger, begegnen Schwierigkeiten. Wölfe ernähren sich vor allem von Wild. In Wolfsgebieten kann es deswegen zu vermehrter Rudelbildung von Schwarz- und Rotwild kommen. Dies kann wiederum zu erschwerter Bejagung führen.
Umfassend geschützt
Entsprechend der geltenden Rechtslage ist der Wolf besonders geschützt. Es ist verboten, geschützte Tiere zu fangen oder sie zu töten, denn wildlebende Tier- und Pflanzenarten sollen zugunsten der biologischen Vielfalt bewahrt oder wiederangesiedelt werden.
Dies regeln die Berner Konvention, die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU und das Bundesnaturschutzgesetz.
Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes
Am 13. März 2020 trat eine Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) mit Regelungen zum Wolf in Kraft. Ziel war ein besserer Schutz der Weidetierhaltung und ein Beitrag zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger in Regionen, in denen Wölfe sich in oder in der Nähe von Wohngebieten aufhalten.
Die Gesetzesänderung erlaubt die erleichterte Entnahme "problematischer" Wölfe. Für Nutztierhalter reicht als Grundlage für eine Abschussgenehmigung aus, dass ihnen ernste wirtschaftliche Schäden drohen. Zudem ist ein Abschuss auch dann möglich, wenn unklar ist, welcher einzelne Wolf die Nutztiere gerissen hat. Es dürfen so lange einzelne Rudelmitglieder in der jeweiligen Gegend entnommen werden, bis es keine Angriffe auf Nutztiere mehr gibt. Die Änderung hatte das Ziel, mehr Rechtssicherheit im Umgang mit dem Wolf zu schaffen und regelt u.a. auch den Umgang mit Wolf-Hund-Hybriden.
Weide- und Nutztierhaltung im Einklang mit dem Wolf
Mehr Wölfe und deren umfassender Schutz dürfen nicht zu weniger Nutztierhaltung im Freien führen. Denn Weidehaltung trägt zum Tierschutz und Erhalt von Grünland bei und ist insbesondere für ökologisch wirtschaftende Betriebe relevant.
Dafür sind Präventionsmaßnahmen notwendig. Im Umgang mit dem Wolf muss eine für alle Beteiligten sachgerechte Lösung gefunden werden, die ökologisch sinnvoll und gesellschaftlich akzeptiert ist. Das BMEL führt daher Gespräche mit Betroffenen und Vertretern der Weidetierhalter zur Erarbeitung von Lösungsansätzen zwischen Wolfsschutz und Nutztierhaltung. Auch auf europäischer Ebene setzt sich das BMEL aktiv für eine Entschärfung der Konfliktsituation und einen angemessenen Interessenausgleich zwischen der Weidetierhaltung und dem Artenschutz ein.
Aufgaben des Bundeszentrums Weidetiere und Wolf
Das im Geschäftsbereich des BMEL befindliche "Bundeszentrum Weidetiere und Wolf (BZWW)" soll u.a. folgende Aufgaben erfüllen:
- Erstellung einer länderübergreifenden Übersicht – jährlich aktualisiert – der angewandten Herdenschutzmaßnahmen (Zaun, Herdenschutzhunde etc.), insbesondere in Wolfsgebieten einschließlich der Erfassung, der bei diesen Herdenschutzmaßnahmen dennoch stattgefundenen Übergriffe, möglichst mit Ursachenforschung.
- Optimierung von aktuell angewandten Schutzmaßnahmen u.a. durch Rückkopplung mit Vertretern der Wissenschaft, Wirtschaft, betroffenen Praktikern und betroffenen Verbänden (ggf. Gründung einer AG).
- Vorschlag neuer Forschungsprojekte zur Entwicklung neuer Herdenschutzmaßnahmen und ggf. neuer Verfahren u.a. durch Nutzung der Digitalisierung.
- Entwicklung und Optimierung von Abläufen des Verfahrens nach einem Übergriff sowie Verbesserung der Verfahren der Entschädigungspraxis in Zusammenarbeit und enger Abstimmung mit den Ländern,
- Klärung von Fragen der Finanzierung und Erarbeitung von Vorschlägen zur Verbesserung der Finanzierung des Herdenschutzes, inklusive Arbeitszeitaufwand.
- Förderung des Dialogs zwischen Weidetierhaltern, den Verbänden des Naturschutzes und der Öffentlichkeit.
- Beratung und Unterstützung des BMEL bei strategischen Überlegungen zum Management des Wolfes aus Sicht der Weidetierhaltung.
Weidetierhalterinnen und -halter finden auf der Internetseite des Bundeszentrums Weidetiere und Wolf (BZWW) fundierte und praxisrelevante Inhalte zu Herdenschutzmaßnahmen, Fördermöglichkeiten in den Bundesländern, praxis- und forschungsbezogene Projekte zum Herdenschutz sowie zu Konfliktlösungsansätzen."
Die Länder sind in der Pflicht
Herdenschutz und Umsetzung der artenschutzrechtlichen Regelungen sind grundsätzlich Ländersache. Der Bund kann lediglich die Länder bei den Empfehlungen für Herdenschutzmaßnahmen unterstützen. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) betreibt seit 2016 eine Dokumentations- und Beratungsstelle für das Wolfsmanagement eingerichtet (www.dbb-wolf.de) für die
- Beratung der Länder,
- bundesweite Sammlung von Daten zur Ausbreitung des Wolfes (Wolfsmonitoring),
- Zusammenstellung und Aktualisierung der Länderregelungen zur Schadensprävention und -kompensation.
Die nach Landesrecht zuständigen Behörden können von den Verboten des Bundesnaturschutzgesetzes im Einzelfall Ausnahmen zulassen. Auffällige Wölfe dürfen unter bestimmten Voraussetzungen der Natur getötet werden. Erforderlich dafür ist eine Situation der konkreten Gefahrenabwehr, z. B. im Interesse der öffentlichen Sicherheit oder um erhebliche landwirtschaftliche Schäden abzuwenden.
Präventionsmaßnahmen
Es ist erforderlich, der ansteigenden Wolfspopulation mit geeigneten Herdenschutzmaßnahmen begegnen. Dafür eignen sich vor allem: Herdenschutzhunde, Elektrozäune, Wildgatterzaun und Behirtung.
Doch die Präventionsmaßnahmen sind kostenintensiv, zeitaufwändig und können nicht in allen Fällen umfassenden Schutz garantieren. So kostet die Anschaffung eines Herdenschutzhundes etwa 4.000 Euro und die artgerechte Haltung des Hundes weitere 1.000 Euro pro Jahr. Vor allem Halter von kleineren Viehbeständen können diese finanziellen Belastungen kaum leisten. Prinzipiell können Herdenschutzmaßnahmen wie der Bau von Zäunen gefördert werden – dies ist jedoch abhängig von den jeweiligen Regelungen der Länder zur Unterstützung von Präventionsleistungen.
Präventionsförderung zum Herdenschutz gegen Wolfsübergriffe durch den Bund (GAK)
Im sogenannten GAK-Rahmenplan sind zwei Maßnahmen zum präventiven Herdenschutz implementiert. Der GAK-Förderungsgrundsatz "Investitionen zum Schutz vor Schäden durch den Wolf" fördert u.a. den Erwerb und die Installation wolfsabweisender Schutzzäune, Nachrüstung vorhandener Zäune, Anschaffung von Herdenschutzhunden, einschließlich Qualifikation von Personen, die mit den Herdenschutzhunden arbeiten sowie die Ausbildung der Hunde. Der GAK-Förderungsgrundsatz "Laufende Betriebsausgaben zum Schutz vor Schäden durch den Wolf" fördert die laufenden Betriebsausgaben für die Wartung von Herdenschutzzäunen und die Unterhaltung von Herdenschutzhunden. Für die Umsetzung der Maßnahmen sind die Länder zuständig.