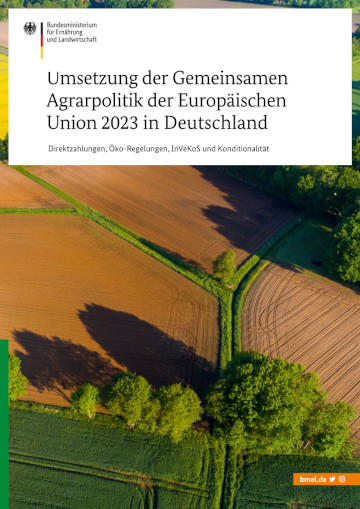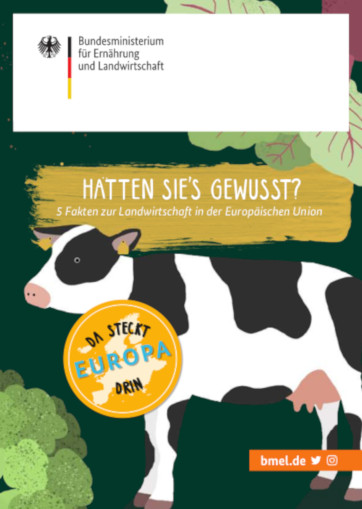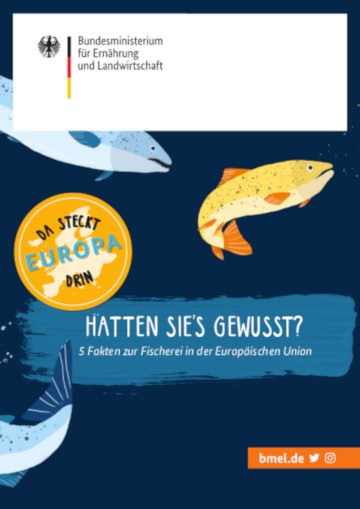Tagung des Rates (Landwirtschaft und Fischerei) am 24. März 2025 in Brüssel
Ergebnisbericht
Leitung der deutschen Delegation: Bundesminister Cem Özdemir
Zusammenfassung
Im Mittelpunkt der Tagung des Rates stand die Vision der KOM zur Zukunft der Landwirtschaft und Ernährung. Agrarkommissar Hansen stellte wesentliche Inhalte vor; es fand ein intensiver Meinungsaustausch statt. Die Mitgliedstaaten (MS) begrüßten die Vision grundsätzlich und äußerten gleichzeitig Prioritäten und fehlende Aspekte. Viele MS forderten eine angemessene finanzielle Ausstattung und die Beibehaltung der Zwei-Säulen-Struktur der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP).
Unter Sonstiges behandelte der Rat auf Antrag von Rumänien die Förderfähigkeit des Ankaufs von Zuchtrindern.
Im Fischereibereich wurde insbesondere die künftige Ausgestaltung des Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (Antrag der Niederlande) und die Umsetzung der Fischereikontroll-Verordnung (Antrag von Lettland und Litauen) behandelt. Das Mittagessen zur Zukunft der Fischereipolitik fand auf Ministerebene (1+0) statt.
Außerdem informierten Ungarn und die Slowakei mit einem Punkt unter ‚Sonstiges‘ über den Ausbruch der Maul- und Klauenseuche (MKS) in ihren Ländern.
Vorsitz kündigte an, dass der nächste AGRIFISH-Rat im Mai stattfinden werde.
Im Einzelnen
TOP Vision der KOM zur Zukunft der Landwirtschaft
Die EU-Kommission (KOM) hatte die Vision am 19.02.2025 veröffentlicht. Eine erste Aussprache fand im Rat am 24.02.2025 statt. Die polnische Präs. (POL-Präs) griff für die Tagung am 24. März drei Aspekte aus der Vision als Fragen an die Mitgliedstaaten auf (allgemeine Einschätzung zu der Vision der KOM, Haltung zur Nutzung von CO2-Zertifikaten und Naturschutzgutschriften als künftige Einkommensquellen sowie die Stärkung von Digitalisierung und Wissenstransfer).
Agrarkommissar Hansen betonte, dass die Vision die strategische Bedeutung von Landwirtschaft anerkenne und die Ernährungssicherheit auch eine Schlüsselpriorität in der Mitteilung zum nächsten Mittelfristigen Finanzrahmen (MFR) sei. Der Sektor stehe wegen der schwierigen geopolitischen Lage vor großen Herausforderungen. KOM arbeite daran, den Sektor attraktiver, wettbewerbs- und zukunftsfähiger auszugestalten, einschließlich fairer Einkommen. Die Landwirte dürften nicht gezwungen sein, unter Produktionskosten verkaufen zu müssen; daher werde die Unfair Trade Practices -Richtlinie (UTP) überarbeitet.
Der Kommissar betonte zudem eine andere Arbeitsweise („new way of working“), die von Vertrauensbildung und Dialog geprägt sein solle, u.a. mit Verweis auf das neue European Board on Agriculture and Food.
Die MS begrüßten grundsätzlich die Vision und dabei insbesondere, dass die Landwirtschaft darin als strategischer Sektor hervorgehoben werde und dass betont werde, wie wichtig es sei, die Berufswahl „Landwirtschaft“ künftiger Generationen zu fördern. Wesentlich sei, die Wettbewerbsfähigkeit und die Widerstandsfähigkeit des EU-Agrarsektors zu stärken. Viele MS hoben die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) hervor, die mit einem eigenen Budget im MFR finanziell gut ausgestattet sein müsse. Teilweise wurde auch das Zwei-Säulen-Modell als erhaltenswürdig erwähnt sowie gekoppelte Zahlungen. Weitere Themen waren die Bedeutung einer fortgesetzten Unterstützung ländlicher Gebiete, die stärkere Angleichung von Produktionsstandards für importierte Lebensmittel und die Notwendigkeit einer Vereinfachung. Einige MS forderten die Vollendung der externen Konvergenz.
Ergänzend zu den anderen traditionellen Einkommensquellen sprach sich eine Reihe von MS für eine Diversifizierung der Einkommensquellen (z. B. Carbon farming) aus. Zur dritten Frage betonten viele MS die Bedeutung von Forschung, Innovation, Präzisionslandwirtschaft, Drohnen und NGT.
Bundesminister Özdemir betonte, dass DEU die Vision und das darin formulierte Zielbild unterstütze. In einer Zeit multipler Krisen solle der Fokus darauf liegen, das EU-Agrar- und Ernährungssystem auch langfristig nachhaltiger, effizienter, resilienter und einfacher zu gestalten. Dazu sei es notwendig, die verschiedenen Zielstellungen zusammenzudenken und gleichermaßen zu stärken. Dies seien Ernährungssicherung, Klima-, Biodiversitäts-, Umwelt- und Tierschutz, Stärkung und Diversifizierung der Handelsbeziehungen sowie Einkommenssicherung und Wettbewerbsfähigkeit. Unabdingbar gehöre dazu, Landwirten gute wirtschaftliche Zukunftsperspektiven zu bieten. Dabei sollten die besonderen Bedarfe von Hofnachfolgern und Existenzgründern beachtet werden. Dazu gehöre auch, lebendige ländliche Räume zu schaffen und als attraktive Lebens- und Arbeitsorte zu stärken und zukunftsfest aufzustellen. Weiterhin sei es wichtig, das Erreichen der Umwelt- und Klimaziele des European Green Deal konsequent zu unterstützen. Das gegenseitige Verständnis und der Wille zur Konsensbildung unterschiedlichster gesellschaftlicher Akteure in Europa sei notwendig. Die Vision bilde eine gute Grundlage dafür, könne aber noch stärker den Aspekt einer anstehenden EU-Erweiterung aufgreifen. Das ebenfalls in der Vision enthaltene Ziel gleichartiger Produktionsbedingungen für Importe aus Drittländern sei kritisch zu sehen, weil der handelspolitische und -rechtliche Spielraum dafür sehr gering sei.
Zur zweiten Frage erläuterte der Bundesminister, dass man nur gemeinsam mit der Landwirtschaft die gesellschaftlichen Ziele beim Schutz von Klima, Umwelt und Natur erreichen könne. Deshalb müssten Betriebe mit diesen Leistungen im Gemeinwohlinteresse, insbesondere ökologischen, ein Einkommen erzielen können und über die zusätzlichen Kosten und das entgangene Einkommen hinaus honoriert werden. Einen möglichen Beitrag zur Diversifizierung und Einkommensstabilisierung könne auch die nachhaltig ausgestaltete Bioökonomie leisten. Auch die Entwicklung neuer, innovativer und für die Landwirtschaft attraktiver Finanzierungsmodelle sei zu prüfen, sofern sie zusätzlich umweltfreundliche Verfahren fördern. Möglicherweise könne eine CO2-Zertifizierung, wie sie auf EU-Ebene bereits vereinbart wurde, oder noch näher zu definierende Naturschutzgutschriften geeignete marktwirtschaftliche Instrumente sein; diese könnten Anreize für Klima-, Umwelt- und Naturschutz sowie zusätzliches Einkommen für die Landwirtschaft ermöglichen. Hierbei sei die praktikable Anwendbarkeit und der zweifelsfreie Nachweis des tatsächlich erbrachten, zusätzlichen Umwelt- und Klimanutzens notwendig. Bei der Zertifizierung und Preisgestaltung sollte auch der zeitliche Aspekt dieser Leistung angemessen berücksichtigt werden. Das geplante Nachhaltigkeits-Benchmarking könne einen Beitrag zu mehr Wettbewerbsgleichheit leisten und als standardisierter Bewertungsrahmen umweltfreundliches Handeln befördern.
Zur dritten Frage führte er aus, dass der interdisziplinären Forschung eine entscheidende Rolle zukomme, weil sie zu innovativen Lösungen beitrage. Programme in den MS, die gezielt Innovationen und neue Technologien im Bereich Landwirtschaft und Ernährung unterstützen, sollten durch Vernetzung und Wissenstransfer besser genutzt werden. Eine bedarfsgerechte digitale Infrastruktur in ländlichen Räumen sei dabei eine wichtige Voraussetzung. Neue Technologien sollten schneller in die Anwendung gebracht werden. Der bürokratische Aufwand solle so gering wie möglich sein und der Grundsatz der Subsidiarität beachtet werden.
Kommissar Hansen erläuterte, dass KOM bis 28. März das Weinpaket und voraussichtlich im Mai das Vereinfachungspaket zur GAP vorlegen werde. Das zweite Vereinfachungspaket werde Ende des Jahres folgen. Noch in diesem Jahr werde KOM den Vorschlag zur künftigen GAP und die Strategie zum Generationswechsel vorlegen. Zu den Forderungen nach einem ausreichenden Haushalt für die GAP und der Beibehaltung der zwei Säulen wies er darauf hin, dass es auch an den MS liege, sich dafür einzusetzen. Er unterstützte den Ansatz, dass die EU wegen der geopolitischen Herausforderungen ihre strategischen Abhängigkeiten reduzieren müsse. Die Wasserresilienzstrategie werde in der KOM unter Beteiligung mehrerer Generaldirektionen erarbeitet.
Der POL-Vorsitz fasste die Diskussion zusammen und hob dabei insbesondere hervor, dass viele MS die Notwendigkeit von Vereinfachung, Gegenseitigkeit in den Handelsbeziehungen, neuen Einkommensquellen und Digitalisierung angesprochen hätten.
Die Beratungen sollen im SAL fortgesetzt werden.
Unter dem TOP Sonstiges wurden folgende Punkte behandelt:
a) High-level Konferenz “Common Agricultural Policy for food security” in Warschau am 5. März 2025 (Präs)
POL Präs. informierte über die o.g. Konferenz, die sich auf das Thema Ernährungssicherheit und die Rolle der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) konzentriert hätte. Als Ergebnis der Diskussionen sei festzuhalten, dass die zukünftige GAP besser an Klimaveränderungen, geopolitische Entwicklungen sowie den Bedürfnissen der Landwirtschaft ausgerichtet sein müsse. Zudem seien Vereinfachung und angemessene Finanzierung wesentlich.
Die wortnehmenden MS dankten der POL Präs. und unterstrichen die Schlüsselrolle der GAP für die Ernährungssicherung. Teilweise wurde die Beibehaltung der Zwei-Säulen-Struktur und eines unabhängigen Agrarhaushaltes gefordert.
Kommissar Hansen betonte, dass die Konferenz gezeigt habe, wie bedeutend die Lebensmittelerzeugung für Europa sei; die Lebensmittelsouveränität sei wesentlicher Bestandteil der Sicherheitsagenda.
b) ELER-Förderung (ROU)
ROU forderte, die Verordnung (EU) 2021/2115 anzupassen, damit Landwirte leichteren Zugang zu Mitteln erhielten, um ihre Tierpopulation aufstocken zu können. Die Förderung des Zuchttiersektors stärke zudem die Lebensmittelproduktion und trage dadurch zur Stärkung von Resilienz, Wettbewerbsfähigkeit Ernährungssicherheit bei. Auch könnten produktivere Rassen im Verbund mit neuen Technologien und Futtermitteln zu geringeren Methanemissionen pro Erzeugnis führen, und damit einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
Die wortnehmenden MS unterstützten den Vorschlag.
Kommissar Hansen betonte, dass bereits verschiedene Stützungsmaßnahmen existierten, um die Herausforderungen im Sektor anzugehen, z. B. gekoppelte Zahlungen, sektorale Interventionen und Investitionsförderungen; eine entsprechende Änderung des Strategieplans sei möglich. Daneben bestünde die Möglichkeit nationaler Beihilfezahlungen; insbesondere könne bei Tierseuchen Unterstützung geleistet werden, um das Produktionspotential wiederherzustellen.
c) Fischerei-Kontrollverordnung (LVA und LTU)
LVA und LTU berichteten, wie schwierig es für Wirtschaftsbeteiligte sei, die neuen Vorschriften der Fischerei-Kontrollverordnung bei pelagischen Arten einzuhalten, da eine genaue Schätzung nicht möglich sei. KOM habe bisher keinen Ansatz zur Lösung des Problems vorgelegt. Die neue Kontrollverordnung sehe eine 20-prozentige Toleranzspanne „für jede Art“ vor, also auch für unregulierte und invasive Arten, die insbesondere bei Fischereien auf Hering und Sprotte mitgefangen würden. KOM solle daher einen Vorschlag für eine Definition, unter welchen Voraussetzungen ein Verstoß als schwer einzustufen sei, vorlegen.
Viele MS unterstützten diese Forderung. FRA forderte zudem, Fristen für bestimmte Maßnahmen der Kontrollverordnung auf 2028 zu verschieben.
Auch DEU unterstützte das Anliegen, da es Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Bestimmungen der erlaubten Toleranzspanne gebe.
Der Kommissar für Fischerei und Meere, Kadis, führte aus, dass die Regeln der Vorgänger-Verordnung für Meldungen nichtquotierter Arten ausgelaufen seien. Die Definition „schwerer Verstoß“ solle auf Grundlage des geltenden Rechts in den Blick genommen werden. Die Toleranzspannen könnten nicht geändert werden, weil das EP als Mitgesetzgeber eine solche Änderung ablehne. Bei den Durchführungsregelungen würde die Vereinfachung immer mitberücksichtigt.
d) Künftige Ausgestaltung des Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (NLD)
NLD stellte eine Informationsnote vor, die von 14 weiteren MS (darunter DEU) unterstützt wird. Darin wird gefordert, die künftige Ausgestaltung des Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) besser an den Herausforderungen wie insbesondere Generationswechsel, Energiewende, Überalterung der Flotte, Digitalisierung, Klimawandel auszurichten.
Bundesminister Özdemir betonte, dass die Bürokratie auf ein Mindestmaß reduziert und die energetische Transformation der Küstenfischerei unterstützt werden sollten. Dies werde durch die Zukunftskommission Fischerei bestätigt. Es seien aber erhebliche Investitionen notwendig, die ohne Fördermittel nicht möglich sein würden.
Eine Reihe von MS sprach sich für eine ausreichende Mittelausstattung bzw. angemessene Berücksichtigung der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) im mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) aus. Der EMFAF müsse in Zukunft flexibler werden.
Kommissar Kadis führte aus, dass die Mittelausschöpfung für die laufende Förderperiode noch gering sei und zur Beschleunigung die nationalen Finanzierungsbeiträge aufgestockt oder andere Finanzierungsinstrumente und staatliche Beihilfen genutzt werden könnten.
Zur Weiterentwicklung des EMFAF nach 2027 er, dass die GFP eine von nur fünf Politiken mit ausschließlicher Zuständigkeit der EU sei. Im Rahmen der Evaluierung der GFP und der Roadmap zur Energiewende werde der Modernisierungsbedarf der Flotte in den Blick genommen. Der nächste MFR biete eine Gelegenheit für die Aufstockung des Haushalts für die Fischerei. Der Vorschlag für den MFR solle im Juli 2025 vorgelegt werden.
e) Kommunikationskampagne zur Aquakultur (KOM)
Kommissar Kadis führte aus, dass KOM - in enger Abstimmung mit den MS – eine Kommunikationskampagne zur Aquakultur mit dem Titel “EU Aquaculture: we work for you with passion” erarbeite. Diese solle größtenteils social-media-basiert sein und vor allem jüngerem Publikum bis ca. 45 Jahre ein positives Bild der EU-Aquakultur vermitteln. Die Kampagne werde auf einem High-Level-Event am 25.03.2025 in Brüssel lanciert.
Die wortnehmenden MS unterstützten die geplante EU-Aquakulturkampagne.
Bundesminister Özdemir begrüßte ebenfalls diese Kampagne und die Tatsache, dass einer von neun EU-Aquakultur-„Botschaftern“ ein Forellenteichwirt aus der Eifel geworden sei.
f) Maul- und Klauenseuche (HUN)
Ungarn (HUN) informierte, dass am 07.03.2025 in einem Milchviehbetrieb nahe der Grenze zur Slowakei ein Ausbruch von Maul- und Klauenseuche (MKS) festgestellt wurde. Die Ursache für die Einschleppung der Infektion sei bislang unklar.
Die Slowakei (SVK) ergänzte, dass am 21.03.2025 bedauerlicherweise MKS auch bei Kühen auf drei Höfen nahe der Grenze zu HUN nachgewiesen worden sei. Durch den Ausbruch der MKS sei der MKS-Freiheitsstatus der Weltorganisation für Tiergesundheit (WOAH) für HUN und die SVK ausgesetzt worden. Alle erforderlichen Bekämpfungsmaßnahmen seien umgehend eingeleitet worden, insbesondere seien alle Tiere der betroffenen Betriebe getötet und unschädlich beseitigt worden. Die erforderlichen Sperrzonen seien eingerichtet.
HUN und SVK baten die KOM um Hilfe beim Ausgleich der enormen wirtschaftlichen Verluste und dankten den MS (darunter DEU) für ihre Unterstützung.
Die wortnehmenden MS bekundeten ihre Solidarität. Teilweise wurde eine europäische Impfstoffstrategie und Hilfen aus EU-Mitteln gefordert.
Bundesminister Özdemir äußerte Solidarität gerade vor dem Hintergrund, dass auch in DEU im Januar 2025 ein Fall von MKS aufgetreten sei, und bot den betroffenen MS Unterstützung an (insbesondere Lieferung von Impfstoff).
Kommissar Kadis begrüßte für die KOM, dass HUN und SVK schnell die notwendigen Maßnahmen ergriffen hätten. KOM werde weiterhin ein koordiniertes Vorgehen sicherstellen und die Drittstaaten auffordern, sich an den Grundsatz der Regionalisierung zu halten.