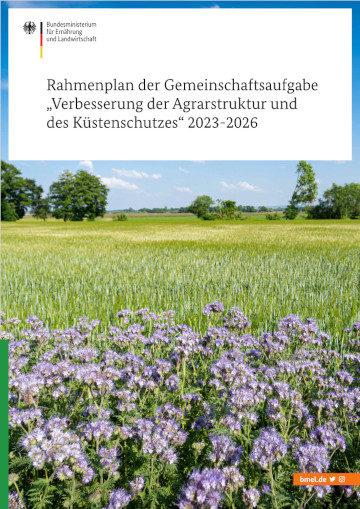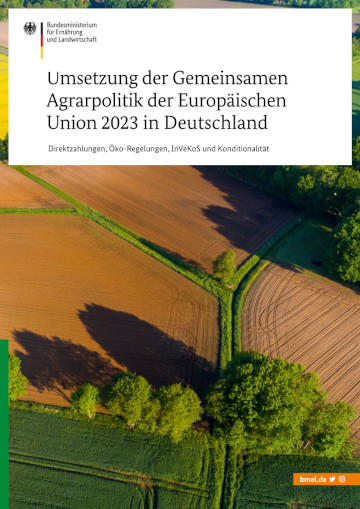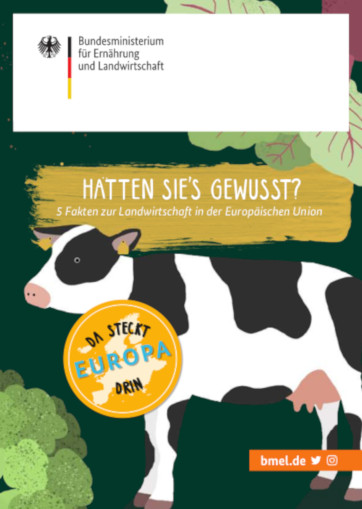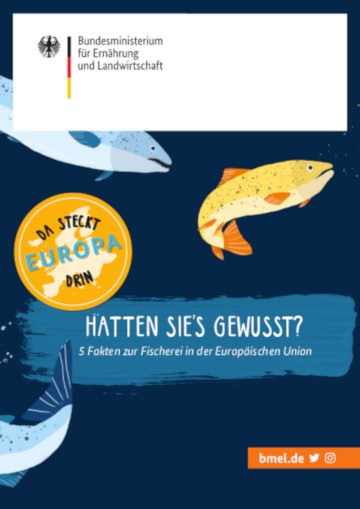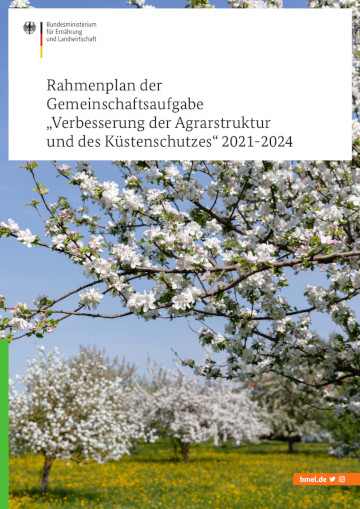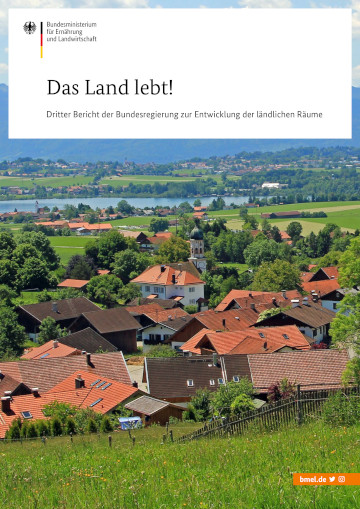Tagung des Rates (Landwirtschaft und Fischerei) am 24. Juni 2024 in Luxemburg
Ergebnisbericht
Leitung der deutschen Delegation: Staatssekretärin Bender
Übersicht:
Ein Schwerpunkt des Rates war die nachhaltige Fischereipolitik. Die Europäische Kommission nahm eine Bestandsaufnahme der Gemeinsamen Fischereipolitik vor und informierte über die Fangmöglichkeiten für das Jahr 2025. Außerdem wurde unter Sonstiges über die Auswirkungen des russischen Vorgehens in der Ostsee sowie die künftige Ausgestaltung der Fischereibeziehungen der Europäischen Union und Norwegen diskutiert. Ein weiterer Schwerpunkt des Rates waren die Beratungen zum Entwurf des BEL-Vorsitzes zu Schlussfolgerungen des Rates über die Zukunft der Landwirtschaft.
Unter Sonstiges standen verschiedene Fortschrittsberichte des BEL-Vorsitzes zu Rechtsetzungsvorhaben während der Präsidentschaft auf der Tagesordnung. Diese betrafen:
- den Verordnungsentwurf über einen Monitoringrahmen für widerstandsfähige europäische Wälder
- die Rechtsvorschriften zum pflanzlichen und den Verordnungsentwurf zum forstlichen Vermehrungsgut sowie
- den Verordnungsentwurf über den Schutz von Tieren während des Transports.
Außerdem berichtete der BEL Vorsitz über das Symposium zu „Nutri Score“ und anderen Systemen der Nährwertkennzeichnung auf Verpackungen.
Weitere Punkte unter Sonstiges waren:
- ein Kauf von Zuchttieren im Rahmen von Strategieplänen im Rahmen der GAP (ROU)
- Verhinderung von Mittelverlust und Verringerung des Verwaltungsaufwandes bei ELER Mitteln (BGR)
- Vorübergehender Krisen und Übergangsrahmen für staatliche Beihilfen: Abschaffung oder Anhebung der individuellen Obergrenze eines landwirtschaftlichen Unternehmens (BGR und ROU)
- Unwetterschäden in der ersten Jahreshälfte 2024 (HRV)
TOP Mitteilung über nachhaltige Fischerei in der Europäischen Union: aktueller Stand und Leitlinien für 2025
Die Europäische Kommission (KOM), Kommissar Sinkevičius, gab einen Überblick über Fortschritte bei der Zielerreichung einer ökologisch nachhaltigen Fischerei. Er informierte zudem über den Zustand der EU Flotte und ihre Wirtschaftsleistung. Hierbei betonte KOM, dass im Vergleich zum Basisjahr 2003 weniger Fischbestände überfischt seien. Problematisch bleibe allerdings weiterhin insbesondere die Ostsee.
Der Fischereisektor stehe angesichts hoher Kraftstoff- und Energiepreise sowie der geopolitischen Lage vor großen Herausforderungen. Im Zentrum müsse eine Stärkung der Resilienz des Sektors spielen. Hierbei spielten Mittel aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFAF), aber auch aus dem Forschungs- und Rahmenprogramm Horizont Europe eine wichtige Rolle.
KOM teilte mit, dass sie eine umfassende Bewertung der Grundverordnung der Gemeinsamen Fischereipolitik einleiten wird, die sich auf die zehn Jahre seit der letzten Reform in 2014 beziehen wird.
Deutschland, Staatssekretärin Bender, begrüßte die Fortschritte, die in vielen Gewässern hin zu einer nachhaltigen Fischerei erzielt wurden. Gleichzeitig sei es erforderlich, insbesondere in der Ostsee an einer Verbesserung des allgemeinen Umweltzustandes zu arbeiten und die ungewollten Beifänge zu reduzieren. Außerdem müsse die neue Kontrollverordnung Verbesserungen bei der Anlandeverpflichtung sicherstellen.
Die wortnehmenden Mitgliedsstaaten betonten teilweise, dass nicht die Fischerei alleine für einen Rückgang von Beständen verantwortlich gemacht werden könne. Weitere Faktoren seien der Klimawandel und die Verbreitung invasiver Arten. Der überwiegende Teil der Mitgliedsstaaten sah wie KOM die Notwendigkeit zur Resilienz – und Rentabilitätssteigerung des Sektors. Ein Modernisierungserfordernis müsse allerdings an die wirtschaftlichen und strukturellen Realitäten in der EU angepasst werden. Auch wurde auf besondere Bedingungen wie Rand- oder Insellage hingewiesen. Mehrere Mitgliedsstaaten sprachen das Erfordernis gleicher Wettbewerbsbedingungen gegenüber Drittstaaten an.
TOP Schlussfolgerungen zur Zukunft der Landwirtschaft in der EU
Unter diesem Tagesordnungspunkt sollten die von BEL-Vorsitz ausgearbeiteten Ratsschlussfolgerungen angenommen werden. Der diesbezügliche Entwurf war zuvor in verschiedenen Sitzungen des Sonderausschusses Landwirtschaft diskutiert und mehrfach angepasst worden. Aufgrund einer DEU Forderung sind u.a. die Verantwortung der Landwirtschaft gegenüber Klima – und Biodiversitätsschutz, der Tierschutz und die Stärkung der Rolle der Frauen in der Landwirtschaft im Text verankert worden.
BEL-Vorsitz (Minister Clarinval) betonte, dass der zur Annahme stehende Text einen Kompromisstext darstelle, der die teilweise unterschiedlichen Positionen der Mitgliedsstaaten aufgreife. Die mit den Schlussfolgerungen verfolgten Ziele seien nicht erschöpfend.
Das zur Annahme als Schlussfolgerungen des Rates erforderliche Einvernehmen des Rates scheiterte am negativen Votum von Rumänien, das forderte, eine Aussage zur externen Konvergenz, bzw. zu einer notwendigen Angleichung der Direktzahlungen, zu treffen. Als Konsequenz wurden die Schlussfolgerungen als Schlussfolgerungen des BEL-Vorsitzes beschlossen.
Deutschland hatte zuvor wie die übrigen Mitgliedsstaaten (Slowakei: Enthaltung) den Schlussfolgerungen zugestimmt, aber eine Protokollerklärung zu den folgenden aus deutscher Sicht nicht ausreichend umgesetzten Aspekten abgegeben:
- Die Erfordernisse des Umweltschutzes müssten als gleichrangiges Ziel neben der landwirtschaftlichen Produktion genannt werden.
- Es können keine Vorfestlegungen zum künftigen Mehrjährigen Finanzrahmen getroffen werden.
- Forderungen nach einer Anwendung von EU-Produktionsstandards auf Importe aus Drittländern sieht Deutschland grundsätzlich kritisch.
KOM (Wojciechowski) bezeichnete die Schlussfolgerungen als einen würdigen Abschluss der BEL-Ratspräsidentschaft und erklärte, dass die KOM diese – und die im Laufe des Diskussionsprozesses – geäußerten Positionen als Basis für künftige Überlegungen heranziehen werde.
TOP Sonstiges
1. Auswirkungen der Maßnahmen Russlands auf die Ostsee und den EU – Binnenmarkt
Unter diesem Tagesordnungspunkt forderten Estland, Lettland, Litauen und Schweden von der Europäischen Kommission ein entschiedenes Vorgehen gegen die nicht nachhaltigen Fischereipraktiken Russlands in der Ostsee bzw. im Nordostatlantik und ein Importverbot für alle Fischereiprodukte aus Russland. Es könne nicht sein, dass der Fisch, der von der EU geschützt werde, von Russland gefischt werde und dann direkt oder auf Umwegen auf dem EU- Markt lande.
KOM (Sinkevičius) erklärte, dass KOM die aktuelle Lage bewusst sei, aktuell jedoch keinerlei Kontakt zu Russland bestehe. Bevor KOM EU Maßnahmen, wie z.B. Einfuhrverbote, prüfe, sei das Meinungsbild der Mitgliedsstaaten wichtig. KOM verwies auf die Möglichkeit der Mitgliedsstaaten, nationale Maßnahmen zu ergreifen (Beispiel Niederlande).
Die wortnehmenden Mitgliedsstaaten unterstützen das Anliegen. Teilweise wurde jedoch darauf hingewiesen, dass vor einer Maßnahmenergreifung Konsultationen mit dem Sektor erforderlich seien, da teilweise Abhängigkeiten von russischen Einfuhren bestünden.
Auch Deutschland teilte die Besorgnis aufgrund der durch Russland verursachten Überfischung wichtiger Bestände in der Ostsee. Gleichzeitig würde ein Importverbot für sämtliche Fischereiprodukte (auch für solche, die nicht aus der Ostsee stammen) eine Abweichung vom bisherigen Prinzip bedeuten, dass die Nahrungsmittelproduktion nicht durch das Sanktionsregime gegen Russland beeinträchtigt werden sollte. Die Auswirkungen müssten daher zunächst geprüft werden.
2. Künftige Entwicklungen der Fischereibeziehungen zwischen der Europäischen Union und Norwegen
Dieser von Deutschland angemeldete Punkt thematisierte die Weiterentwicklung der teilweisen schwierigen fischereipolitischen Beziehungen der EU zu Norwegen. Seit dem Brexit verfolge Norwegen eine Strategie, die Aufteilung von Beständen zum Nachteil der EU zu verändern und die EU aus historischen Fanggebieten zu verdrängen. Deutschland betonte die Herausforderungen, vor denen die EU und die Partner im Nordostatlantik gemeinsam stehen und schlug vor, Norwegen eine strategische Partnerschaft in globalen Fischereifragen anzubieten, sobald die trennenden Fragen gelöst seien.
Das deutsche Anliegen wurde offiziell von Estland, Spanien, Frankreich, Belgien, Polen, Schweden, Irland, Lettland, Portugal und Niederlande unterstützt. In der Aussprache äußerten sich weitere Mitgliedsstaaten unterstützend.
KOM (Sinkevičius) äußerte die Sorge, dass Norwegen als Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraumes einerseits präferentiellen Marktzugang genieße, anderseits die historischen Fangquoten nicht akzeptiere. KOM werde sich weiterhin intensiv um Lösungen bemühen.
3. Aktuelle Gesetzgebungsvorschläge
Der BEL- Vorsitz gab Fortschrittsberichte zu folgenden Legislativvorschlägen, die unter HUN-Vorsitz weiterverhandelt werden:
I. Verordnung über einen Monitoringrahmen für widerstandsfähige europäische Wälder
Dieser Vorschlag enthält Systeme zur Identifizierung von Waldeinheiten, zur Datenerhebung durch Fernerkundungsdaten und durch die Mitgliedstaaten, zum Datenaustausch, zur schrittweisen Ausdehnung der Datenerhebung, sowie organisatorische Vorgaben und die freiwillige Erstellung langfristiger integraler Pläne.
Die wortnehmenden Mitgliedsstaaten meldeten wie Deutschland Klärungs- und Verhandlungsbedarf, insbesondere zur sicheren Datennutzung, zu technischen Details des geografischen Informationssystems sowie zum finanziellen und personellen Aufwand für die Umsetzung der Verordnung an. Außerdem wurde auf die Kompetenzverteilung zwischen der EU und den Mitgliedsstaaten, insbesondere bei Art. 13 des Verordnungsvorschlages (Waldplanung) hingewiesen.
II. Gemeinsame Behandlung: Rechtsvorschriften über Pflanzenvermehrungsmaterial sowie Verordnung über forstliches Vermehrungsgut (= FRM)
Mit der Novellierung der EU-Vorschriften für pflanzliches Vermehrungsmaterial soll die bisherige Richtlinie durch eine neue EU-Verordnung ersetzt werden. Der Vorschlag umfasst Berichtspflichten und die Einführung einer obligatorischen Wertprüfung für Obst- und Gemüsesorten. Zu diesem Vorhaben sind noch technische Diskussionen auf Arbeitsebene nötig.
Hinsichtlich der Verordnung über forstliches Vermehrungsgut ist die Frage des Verhältnisses zur Kontrollverordnung noch offen.
Verschiedene Mitgliedsstaaten merkten in der Diskussion an, dass der Verwaltungsaufwand für Behörden und Wirtschaftsbeteiligte reduziert werden müsse. Außerdem müsse auf nationale Besonderheiten und die Artenvielfalt Rücksicht genommen werden. Auch müsse der Klimawandel stärkere Berücksichtigung finden,
III. Verordnung über den Schutz von Tieren beim Transport
Der Vorschlag zielt darauf, die Regelungen über den Schutz von Tieren beim Transport weiterzuentwickeln und regelt Transporte „im Rahmen einer wirtschaftlichen Tätigkeit“, insbesondere landwirtschaftlich genutzter Tiere, sowohl innerstaatlich als auch bei Verbringung und Ausfuhr. Deutschland begrüßte so wie andere Mitgliedstaaten die geplanten Verbesserungen des Tierschutzes beim Transport. Insbesondere bei Jungtieren brauche man bessere Regeln für Transporte über weite Strecken.
Wortnehmenden Mitgliedsstaaten betonten zudem die Notwendigkeiten, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse in den Vorschlag einzubeziehen. Außerdem sollte auf regionale, klimatische und sozioökonomische Bedingungen Rücksicht genommen werden.
4. Symposium „Erfahrungen und Perspektiven zu Nutri-Score und anderen Systemen zur Nährwertkennzeichnung auf Verpackungen“
BEL-Vorsitz berichtete über die Ergebnisse des Symposiums, welches am 25. April 2024 in Brüssel stattfand. Deutschland begrüßte die Durchführung des Symposiums und erklärte, dass die Veranstaltung erneut gezeigt habe, dass eine wissenschaftlich fundierte Nährwertkennzeichnung ein wichtiges Instrument zur Förderung einer gesunderen Ernährung sei und bat die KOM, den angekündigten Legislativvorschlag für ein EU-weit einheitliches und verpflichtendes Nährwertkennzeichnungssystem vorzulegen.
Die wortnehmenden Mitgliedsstaaten äußerten sich ebenfalls überwiegend positiv zur Frage einer verpflichtenden Nährwertkennzeichnung, es gab aber auch kritische Stimmen, die darin eine mögliche Verwirrung der Verbraucherinnen und Verbraucher sahen.
5. Einführung der Förderfähigkeit von Ausgaben für den Erwerb von Zuchttieren im Rahmen der GAP-Strategiepläne
Dieser Punkt war von Rumänien angemeldet worden und hat zum Inhalt, eine Zuschussfähigkeit von Ausgaben für den Kauf von Zuchttieren im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu ermöglichen. Dieses Anliegen wurde von einigen Mitgliedsstaaten unterstützt, die betonten, mit einer solchen Möglichkeit könne ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Viehzucht und zur Verbesserung der Ernährungssicherheit geleistet werden.
KOM (Wojciechowski) erläuterte, dass die GAP-Strategieplanverordnung den von ROU vorgeschlagenen Ansatz nicht zulasse und verwies auf andere Fördermöglichkeiten. Dies schließe nicht aus, dass über das von ROU vorgeschlagenen Anliegen in die Überlegungen zur künftigen Gemeinsamen Agrarpolitik einfließe.
6. Maßnahmen zur Verhinderung von Verlusten von Finanzmitteln und Verringerung des Verwaltungsaufwands bei der Verwaltung der ELER-Mittel
Dieser Tagesordnungspunkt wurde von Bulgarien angemeldet und von Griechenland, Litauen, Rumänien, der Slowakei und Tschechien offiziell unterstützt. Die genannten Mitgliedsstaaten forderten die KOM auf, den ELER-Förderzeitraum um 12 Monate bis Ende 2026 zu verlängern und ebenfalls die Fristen für den Abschluss der Förderperiode 2014 bis 2020 um 12 Monate zu verlängern. Auf diese Weise gingen keine Mittel verloren und könnten für die Finanzierung der ländlichen Entwicklung verwendet werden. Weitere wortnehmende Mitgliedsstaaten unterstützten dieses Anliegen.
KOM (Wojciechowski) erläuterte, dass es nicht möglich sei, den bestehenden Rechtsrahmen zu ändern. Unter Beachtung der beihilferechtlichen Grundsätze könnten aber nationale Mittel zur Finanzierung von ländlichen Entwicklungsmaßnahmen verwendet werden.
7. Antrag auf Aufhebung oder Erhöhung der Begrenzung staatlicher Beihilfen pro Unternehmen in der landwirtschaftlichen Primärproduktion auf der Grundlage des Befristeten Rahmens zur Krisenbewältigung und zur Gestaltung des Wandels
Dieser Punkt war von Bulgarien und Rumänien angemeldet worden und wurde von Polen offiziell unterstützt. Inhaltlich wurde gefordert, die Einzelobergrenzen der Beihilfeförderung für Unternehmen in der landwirtschaftlichen Primärproduktion im Rahmen des vorübergehenden Krisen- und Übergangsrahmens für staatliche Beihilfen entweder auf 560.000 € pro Betrieb anzuheben oder gänzlich abzuschaffen. Begründet wurde dies mit den Folgen des Krieges in der Ukraine und Extremwetterereignissen.
Verschiedene wortnehmende Mitgliedsstaaten unterstützten dieses Anliegen.
Einige Mitgliedsstaaten wiesen demgegenüber auf eine mögliche Wettbewerbsverzerrung hin.
KOM (Wojciechowski) argumentierte ebenfalls mit der Gefahr einer Wettbewerbsverzerrung. Es gebe bereits mit der Möglichkeit einer Gruppenfreistellung oder der „De-Minimis“ Förderung weitere beihilferechtliche Fördermöglichkeiten. Gleichwohl habe man das Anliegen an die Generaldirektion Wettbewerb weitergeleitet.
8. Erhebliche Schäden in landwirtschaftlichen Gebieten aufgrund ungünstiger Witterungsbedingungen
HRV verwies auf die massiven Unwetterschäden Anfang Juni an landwirtschaftlichen Kulturen und Betrieben und forderte, alle Möglichkeiten der Abschwächung der schädlichen Auswirkungen auf extreme Wetterphänomene auf den Agrarsektor zu prüfen. Dies beinhalte die Prüfung der Anwendung des EU-Solidaritätsfonds.
Zahlreiche Mitgliedsstaaten, so auch Deutschland, solidarisierten sich mit HRV.
Deutschland verwies zudem auf die starken Überschwemmungen in Süddeutschland in den letzten Wochen sowie die Frostschäden in Obst- und Weinbau in den ost- und süddeutschen Bundesländern im April. KOM (Wojciechowski) appellierte an die Mitgliedsstaaten, die Möglichkeiten der Nationalen Strategiepläne für eine Abfederung zu nutzen.