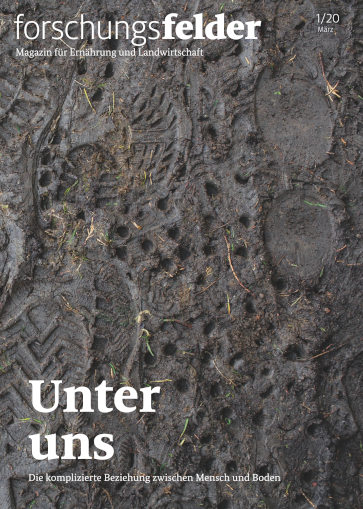Nachhaltiger Schutz vor Wassererosion
Bodenerosion durch Wasser und Wind ist sowohl weltweit als auch in Deutschland das bedeutendste Problemfeld des landwirtschaftlichen Bodenschutzes.Wassererosion (Foto 1) führt zu einem irreversiblen Verlust an fruchtbarem Ackerboden, an Humus sowie an Nährstoffen. Das verringert unumkehrbar die Ertragsfähigkeit von Böden (aid, 2015). Außerhalb von Ackerflächen kann abgetragenes Bodenmaterial und abfließendes Wasser zu erheblichen Schäden und Kosten führen (Foto 2) (aid, 2015).


Wassererosion (Foto 1) führt zu einem irreversiblen Verlust an fruchtbarem Ackerboden, an Humus sowie an Nährstoffen. Das verringert unumkehrbar die Ertragsfähigkeit von Böden (aid, 2015). Außerhalb von Ackerflächen kann abgetragenes Bodenmaterial und abfließendes Wasser zu erheblichen Schäden und Kosten führen (Foto 2) (aid, 2015).
Nachfolgend sind einzelne bzw. in Kombination anwendbare Maßnahmen der Guten fachlichen Praxis zur Vorsorge gegen Wassererosion und Winderosion genannt (nach aid, 2015).


Acker- und pflanzenbauliche Maßnahmen gegen Wassererosion
- Konservierende Bodenbearbeitung/Direktsaat und Streifenbearbeitung mit Belassen einer bodenschützenden Mulchauflage sowie Erhalt stabiler Bodenaggregate möglichst im gesamten Fruchtfolgeverlauf, mindestens jedoch zu einzelnen, von Erosion besonders betroffenen Fruchtarten (insbesondere Mais, Zuckerrüben) im Sinne eines flächenhaft wirkenden Schutzes,
- Minimierung der Zeitspannen ohne Bodenbedeckung, u. a. durch Fruchtfolgegestaltung, Zwischenfrüchte sowie Untersaaten,
- Vermeidung oder Intervallbegrünung hangabwärts gerichteter Fahrspuren,
- Bodenstrukturverbesserung und -erhalt durch Kalkung,
Ergänzende Maßnahmen gegen Wassererosion
- Schlagunterteilung bzw. Hanggliederung durch Fruchtartenwechsel,
- Dauerbegrünung von besonders gefährdeten Acker(teil)flächen bzw. Hangdellen und –rinnen,
- Auf den Schutz vor Bodenerosion ausgerichtete Flurneuordnungsverfahren: Bewirtschaftung quer zum Hang, Anlage quer zum Gefälle laufender Grün- sowie Flurgehölzstreifen, Anlage von Wegseitengräben und ausreichend dimensionierten Durchlässen, ggf. Schaffung von Sedimentationsraum im Hangbereich,
- Vermeiden von Fremdwasserzutritt auf Ackerflächen durch fachgerechte Wasserableitung vom Oberlieger.


Eine Mulchbedeckung von 30-50 Prozent gewährt meist einen ausreichenden Erosionsschutz (Frielinghaus, 1998; aid, 2015). Dies kann durch das Zurücklassen von Pflanzenrückständen (z. B. Stroh) und/oder durch Zwischenfruchtanbau mit einer nachfolgenden Mulchsaat erreicht werden (Foto 3).
Die dauerhaft konservierende Bodenbearbeitung (Foto 4) und die Direktsaat (Foto 5) sind die wirkungsvollsten Erosionsschutzmaßnahmen auf Ackerflächen (Sommer, 1999; Brunotte, 2003; aid, 2015). Durch den Verzicht auf die Bodenwendung mit dem Pflug verbleiben stabile Bodenaggregate sowie bodenbedeckendes Mulchmaterial (Ernte- und Strohrückstände) an der Oberfläche.


Die Mulchauflage schützt den Ackerboden insbesondere in einem aufwachsenden Pflanzenbestand mit noch geringem Bedeckungsgrad (z. B. Zuckerrüben, Mais). Neben der Bodenbedeckung ist auch die im Vergleich zu gepflügten Flächen deutlich gesteigerte Wasserinfiltration infolge geänderter wichtiger Bodenparamater dafür verantwortlich. So wird die Verschlämmungsanfälligkeit des Bodens auf dauerhaft konservierend bestellten Ackerflächen durch die Verbesserung und Stabilisierung der Struktur der Bodenaggregate und höhere Humusgehalte im oberen Krumenbereich sowie eine schützende Mulchauflage an der Bodenoberfläche vermindert.


Die Mulchauflage erhöht zudem den Regenwurmbesatz und die mikrobiologische Aktivität. Der höhere Regenwurmbesatz, insbesondere grobporenerzeugende tiefgrabende Regenwürmer, sorgt darüber hinaus für eine größere Zahl wasserableitender, infiltrationsverbessernder Grob- bzw. Makroporen (Krück et al., 2001, Nitzsche et al., 2002). Infolgedessen vermindert die konservierende Bodenbearbeitung bzw. Direktsaat Wassererosion auf Ackerflächen im Vergleich zu gepflügten Flächen um bis zu 90 Prozent, im Einzelfall wird die Erosion vollständig verhindert. Die verbesserte Wasserinfiltration sorgt zudem für eine effizientere Nutzung von Niederschlägen.
Eine zu intensive Bearbeitung (z. B. mehrere Grubberarbeitsgänge) kann die Wassererosion erhöhen. Deshalb muss die bearbeitungsbedingte Eingriffsintensität auf konservierend bestellten Ackerflächen auf das acker- und pflanzenbaulich notwendige Maß reduziert werden.


Auf Direktsaatflächen ist daher die Wassererosion am geringsten. Direktsaat und eine zielgerichtete Bearbeitung zur angebauten Fruchtart können bei der Streifenbearbeitung kombiniert werden. Bei diesem Bestellverfahren wird die Bodenbearbeitung (z. B. zu Mais) auf die Bereiche beschränkt, in denen die Aussaat erfolgt. So bleibt der größere Teil der Ackerfläche mulchbedeckt (Foto 6). Durch Streifenbearbeitung kann ein mit Direktsaatflächen vergleichbarer Erosionsschutz erreicht werden.
Eine unverzichtbare Maßnahme ist auch die bedarfsgerechte Kalkung der Ackerböden. Sie fördert das Bodenleben, sorgt für stabile Bodenaggregate und wirkt so gegen die Verschlämmung (aid, 2015).


Erosionsschadensfälle belegen, dass nur dauerhaft konservierende Bodenbearbeitung im gesamten Fruchtfolgeverlauf einen nachhaltig wirksamen Erosionsschutz sicherstellt. Ein einmaliger Pflugeinsatz beseitigt diese erosionsmindernden Effekte der konservierenden Bodenbearbeitung (Foto 7) und erhöht dadurch die Erosionsgefährdung von Ackerflächen.
Die dauerhaft konservierende Bearbeitung verlangt jedoch veränderte bzw. neue Anbaustrategien, vor allem im Hinblick auf einen möglichst geringen Pflanzenschutzmitteleinsatz. Der Bodengefügeschutz stellt zudem Anforderungen an die Landtechnik. Daher sind noch Wissens- und Erfahrungslücken zu schließen (aid, 2015), insbesondere bezüglich
- Umgang mit Stroh auf abgeernteten Feldern (Häckselqualität, Strohverteilung),
- Stoppel- und Grundbodenbearbeitung sowie Saatbettbereitung,
- Durchwuchs-, Unkraut- und Ungrasbekämpfung,
- Krankheits- (z. B. Fusariuminfektionen) und Schädlingsmanagement (z. B. Schnecken, Mäuse),
- Auswahl und Beschaffung geeigneter Sätechnik,
- Düngungsstrategie,
- eine spezifische, möglichst vielgestaltige Fruchtfolge,
- die Anwendung neuer erosionsmindernder Anbauverfahren (z. B. Gleichstandsaat) (Demmel et al., 2000 in aid, 2015).
Die landwirtschaftlichen Fachbehörden des Bundes und der Länder erproben und entwickeln hierzu Lösungen und Empfehlungen. Sie bilden die Grundlage für die umfassende und dauerhafte Anwendung der konservierenden Bodenbearbeitung möglichst im gesamten Fruchtfolgeverlauf.
So kann z. B. insbesondere der Herbizidaufwand im Rahmen der dauerhaft konservierenden Bodenbearbeitung durch vielgestaltige Fruchtfolgen mit dem stetigen Wechsel von Blatt- und Halmfrucht und unter der Voraussetzung der gezielten Bekämpfung von Problemunkräutern in der Halmfrucht bzw. von Ungräsern in der Blattfrucht gesenkt werden. Durch den konsequenten Wechsel zwischen Winterung und Sommerung können unkrautunterdrückende abfrierende Zwischenfrüchte angebaut werden (Brust und Gerhards, 2012), wodurch die nachfolgende Direktsaat der Sommerung ggf. ohne vorherigen Herbizideinsatz ermöglicht wird (s. a. Schmidt und Lorenz, 2014). Zusätzlich ist z. B. durch die mechanische Unkraut- / Ungrasbekämpfung auf Stoppelflächen mit weiter- bzw. neu entwickelten GPS-gesteuerten Flachgrubbern bzw. Hackgeräten, durch den Einsatz von Sensortechnik zur teilschlagspezifischen und ggf. einzeldüsengesteuerten Unkraut- und Ungrasbekämpfung sowie durch die Beachtung von Witterung, Spritzbrühenbeschaffenheit, Düsenauswahl usw. ein Ackerbau mit weniger Herbiziden möglich.


Eine Herbizideinsparung kann auch durch die Aussaat von z. B. Winterweizen ohne Saatbettbearbeitung direkt in mechanisch mit einer Messerwalze bearbeitete Zwischenfruchtbestände (Foto 8) erreicht werden. Erfolgt die Zwischenfruchtaussaat sofort nach der Raps- bzw. nach einer frühen Wintergetreideernte, dann unterdrücken konkurrenzstarke Zwischenfrüchte bzw. Zwischenfruchtgemenge auch im relativ kurzen Zeitraum bis zur Aussaat von z. B. Winterweizen die aufwachsenden Ausfallpflanzen sowie Unkräuter. Die auf dem Boden aufliegenden Zwischenfruchtreste verhindern zudem nach der Getreideaussaat den Aufwuchs von Unkräutern und Ungräsern.


Praktikererfahrungen belegen, dass auf diese Weise ohne vorherigen Herbizideinsatz gleichmäßige Getreidebestände mit guten Erträgen etabliert werden können. Der Nachbau von Wintergetreide nach einer frühräumenden Wintervorfrucht wie z. B. Raps ist auf diese Weise trotz dem schmalen Zeitfenster mit Hilfe von Zwischenfrüchten ohne Herbizideinsatz bei sicherer Bekämpfung von Ausfallpflanzen, Unkräutern und Ungräsern möglich. Der Zwischenfruchtanbau hat zudem keinen negativen Einfluss auf die Wasserversorgung der Folgefrucht. Untersuchungen deuten an, dass sich der unproduktive Wasserverlust von Ackerböden durch die verdunstungshemmende Wirkung des Zwischenfruchtmulchs weiter reduzieren lässt (Schmidt et al., 2013).
Die acker- und pflanzenbaulichen Maßnahmen gegen Erosion können durch folgende Maßnahmen ergänzt werden (aid, 2015):
- Hanggliederung bzw. Schlagunterteilung/-neugestaltung durch Fruchtartenwechsel,
- Dauerbegrünung von Hangdellen bzw. -rinnen und von gefährdeten Acker(teil)flächen durch Anlage von Grünland (Foto 9), Anbau schnellwachsender Hölzer (Kurzumtriebsplantagen),
- Anlage querlaufender Grün- bzw. Stilllegungsstreifen bzw. Ranken auf der Ackerfläche oder zwischen Ackerfläche und z. B. einem Gewässer (Foto 10), Flurgehölzstreifen oder Wege mit Wegseitengräben.


Der erosionsmindernde Effekt dieser Schutzmaßnahmen kann nur in Kombination mit der dauerhaft konservierenden Bodenbearbeitung/Direktsaat zu allen angebauten Fruchtarten optimiert werden.
Beispielsweise mindern im Verlauf von geneigten Ackerflächen oder im Ackerrandbereich angelegte Grün-, Brache- und Flurgehölzstreifen die Wassererosion auf den Ackerflächen selbst nur gering. In Abhängigkeit der Oberflächenabflussgeschwindigkeit und der Rauigkeit des Grünstreifens (Foto 10) kann es zu einer Sedimentation mitgeführter Bodenteilchen im Grünstreifen kommen. Dies reduziert den Bodenaustrag in angrenzende Bereiche. Ein wirksamer Erosionsschutz der oberhalb eines Grünstreifens liegenden Ackerflächen ist jedoch nur durch die konservierende Bodenbearbeitung bzw. Direktsaat zu erreichen.
Entscheidend für die Umsetzung ergänzender Schutzmaßnahmen sind Fragen der damit ggf. verbundenen Bewirtschaftungseinschränkung auf Ackerflächen, acker- und pflanzenbauliche Auswirkungen (z. B. von Randstreifen ausgehende Verunkrautung/Verungrasung bzw. Besiedlung von Ackerflächen durch Mäuse, Schnecken usw.), Ertragsverluste, Fragen der Besitzverhältnisse (Flächenbesitzer muss der evtl. mit geringeren Pachteinnahmen verbundenen Umwandlung von Acker in Grünland bzw. der Nutzungsänderung zustimmen) etc. Im Einzelfall kann durch die Nutzung von Fördermitteln ein entsprechender finanzieller Ausgleich geschaffen werden. Die Begrünung von Hangrinnen, die Anlage von Grünstreifen usw. können, wie auch der Zwischenfruchtanbau, im Rahmen des Greenings geltend gemacht werden.
Inwieweit ergänzende Maßnahmen einen zusätzlichen Erosionsschutz bewirken, kann mit Modellen geprüft werden (z. B. Erosionssimulationsmodell EROSION-3D).
Aktiver Erosionsschutz kann auch darin bestehen, auf den Anbau von Reihenfrüchten zu verzichten (z. B. Anbau von Kleegras oder Luzerne statt Mais) oder besonders gefährdete Ackerflächen zugunsten anderer, weniger empfindlicher Nutzungen, wie z. B. Grünland oder Wald, aufzugeben (aid, 2015).
Ein Beitrag von Dr. Walter Schmidt und Ellen Müller, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Nossen


Hinweis: Der voranstehende Text diente als Grundlage für den Beitrag "Nachhaltiger Schutz vor Wassererosion", erschienen in B & B Agrar Heft 4/2015, S. 16-17.
Literatur
aid (2015): Gute fachliche Praxis – Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz. Heft 3614. Hrsg.: aid Infodienst – Ernährung Landwirtschaft und Verbraucherschutz e.V., Bonn, 118 S.
Brust, J. und R. Gerhards (2012): Unkraut und Ausfallgetreide unterdrücken. Landwirtschaft ohne Pflug, Heft 7, S. 34-39
Demmel, M., Hahnenkamm, O., Kornmann, G. und M. Peterreins (2000): Gleichstandsaat bei Silomais. Landtechnik 3, S. 201-211
Frielinghaus, M. (1998): Bodenbearbeitung und Bodenerosion. In: Bodenbearbeitung und Bodenschutz. Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (Hrsg.). KTBL-Arbeitspapier 266, S. 31-55
Krück, S., Nitzsche, O. und W. Schmidt (2001): Regenwürmer vermindern Erosionsgefahr. Landwirtschaft ohne Pflug, Heft 1, S. 18-21
Nitzsche, O., Krück, S., Zimmerling, B. und W. Schmidt (2002): Boden- und gewässerschonende Landbewirtschaftung in Flusseinzugsgebieten. Schriftenreihe der Sächsischen Landesanstalt für Landwirtschaft, Heft 11, S. 1-22
Schmidt, A., Böttcher, F. und M. Schmidt (2013): Gründüngung mit vielen Vorteilen. Landwirtschaft ohne Pflug, Heft 6, S. 28–35
Schmidt, W. und B. Lorenz (2014): Weniger Menge, mehr Ackerbau. DLG-Mitteilungen, Heft 7, S. 15-17
Sommer, C. (1999): Konservierende Bodenbearbeitung – ein Konzept zur Lösung agrarrelevanter Bodenschutzprobleme. Bodenschutz 1, S. 15-19