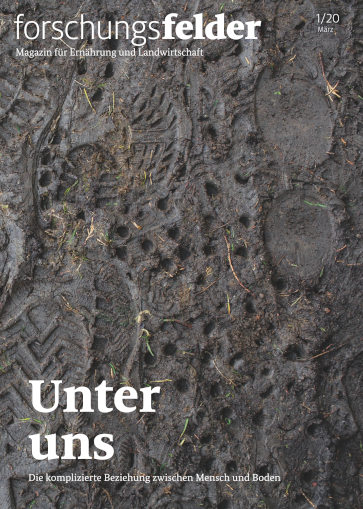Regenwürmer als Indikator für die Bodenfruchtbarkeit
Der Boden ist Lebensraum zahlreicher Organismen. Ihr wichtigster Vertreter ist der Regenwurm, der für die Steigerung der Bodenfruchtbarkeit eine Schlüsselfunktion besetzt.
Bereits Darwin (1904) erkannte die herausragende Bedeutung der Regenwürmer (Lumbricidae) für das Bodenökosystem. Es wird angenommen, dass Regenwürmer seit etwa 200 Mio. Jahren die Erde besiedeln (Vetter 2003). In einem Hektar gesunden Grünlandboden leben eine bis drei Millionen Regenwürmer (Pfiffner 2013). Wie viele Regenwürmer in einem Boden leben (Abundanz) bestimmt man durch Austreiben der Tiere mit Formaldehyd (DIN 23611-1:2006, Stoeven und Schnug 2009).
In Deutschland sind 39 Arten aus der Familie der Lumbricidae bekannt (Graff 1983), an einem Standort kommen etwa 2 - 9 Spezies vor (Römbke et al. 1997). Anhand ihres Lebensraumes werden epigäische (Bewohner der Streuschicht) von anözischen (Tiefgräber) und endogäischen (Bewohner des Mineralhorizontes) Arten unterschieden. Allerdings können die Lumbricidae je nach Lebensalter und Umweltbedingungen zwischen diesen Lebensräumen wechseln (Römbke 1997). Regenwürmer reagieren besonders sensibel auf wechselnde Bodenfeuchtigkeit und sind gegen Trockenheit (< 20 Prozent Bodenfeuchte) sehr empfindlich. Weiterhin hat der pH-Wert des Bodens eine große Bedeutung für die Verbreitung von Regenwürmern. Die meisten Arten bevorzugen neutrale bis leicht basische Milieus (Römbke 1997).


Lumbricide bewegen sich bohrend und fressend durch den Boden und hinterlassen bis zu 5 mm dicke Röhren (Bioporen), die für die Durchlüftung und Drainage des Bodens wichtig sind (Gisi 1990) und das Wachstum von Pflanzenwurzeln besonders in verdichtetem Boden erleichtern (Spiegel 2011). Böden mit hohen Regenwurmbesätzen nehmen mehr Wasser auf und sind ein besonderer Beitrag zum vor beugenden Hochwasserschutz (Lilienthal und Schnug, 2011). Da Regenwürmer nur einen geringen Teil der in der Streu (abgestorbene pflanzliche Substanz wie Gräser und Blätter) enthaltenen Energie nutzen können, müssen sie nach Vetter (2003) täglich etwa die Hälfte ihres Eigengewichtes als Nahrung aufnehmen, vornehmlich Streu von der Bodenoberfläche, die sich im Darm der Tiere mit den ebenfalls aufgenommenen mineralischen Bodenpartikeln vermischt. Durch mehrmaliges Fressen und Ausscheiden des Kotes erfolgt eine Aufkonzentration der Nährstoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium um das fünf-, sieben- bzw. 11-fache der Ausgangskonzentration im Boden (Vetter 2003) und damit eine sukzessive Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit. Im Darm des Wurmes werden die zunächst unverdaulichen organischen und anorganischen Bestandteile durch Darmsekrete miteinander verkittet und es werden feste organo-mineralische Verbindungen, bzw. Ton-Humus-Komplexe gebildet (Topp 1981), die ein Krümelgefüge ergeben und die Bodenstruktur festigen, was Erosion vermindert und Wasseraufnahme fördert (Spiegel 2011). Die auf der Streuoberfläche befindlichen Bakterien und Pilze werden während der Darmpassage nicht abgetötet und tragen zur Zersetzung der pflanzlichen Substanz im Darm des Wurmes bei. Das Absetzen der Kothaufen mit leicht verwertbaren Nährstoffen erfolgt an anderer Stelle als die Nahrungsaufnahme. Dabei kommt es zur Einmischung von Streu in den Boden bei gleichzeitiger Düngung mit Stickstoff, Phosphor und Kalium. Regenwurmkot verbessert somit maßgeblich die Bodenstruktur und ist eine Nährstoffquelle für Pflanzen und Bodenfauna. In den mit Kot ausgekleideten (Losungstapete) Regenwurmröhren leben 40 % der Stickstoff-fixierenden Bakterien des Bodens. Regenwürmer produzieren zwischen 40 und 70 Tonnen Kot pro Jahr und Hektar (Spiegel 2011). Der nährstoffreiche Kot dient Bodenorganismen geringerer Größe, z.B. Asseln, Doppelfüßlern, Nematoden und Collembolen als Nahrung (Topp 1981). Sogar ein toter Regenwurm trägt noch mit bis zu 10 mg Stickstoff in seiner Biomasse zur natürlichen Bodenfruchtbarkeit bei.
Regenwürmer stellen Ansprüche an ihren Lebensraum und sind daher Zeigerorganismen bzw. Indikatoren für den ökologischen Zustand eines Bodens. Eingriffe in den Boden, z.B. bei Bodenbearbeitung, Düngung oder Pestizid-Einsatz verändern auch die Lebensbedingungen der Regenwürmer und deren Biozönose (Lebensgemeinschaft) tiefgreifend.

Trotz allem was man über Regenwürmer zu wissen glaubt, vieles am Bodenleben ist noch unerforscht, der Lebensraum Boden ist immer noch "Terra incognita" (Durner 2002).
Ein Beitrag von Kirsten Stöven, Frank Jacobs und Ewald Schnug (Julius Kühn-Institut (JKI) - Institut für Pflanzenbau und Bodenkunde).
Literatur
Darwin, C. (1904): The formation of vegetable mould through the action of worms with observations on their habits. London : Marray, 298 p
Gisi, U. (1990): Bodenökologie. Stuttgart : Thieme, 304 p, ISBN 8-13-747201-6
Graff, O. (1983): Unsere Regenwürmer – Lexikon für Freunde der Bodenbiologie. Hannover : Verlag M.& H. Schaper, 112 p, ISDN 3-7944-0127-1
Lilienthal, H. und Schnug, E. (2011) Vorbeugender Hochwasserschutz – Bioböden sind die besseren Wasserspeicher. Ökologie & Landbau, Band: 158, Seite(n):20-22; ISSN/ISBN: 0171-7456, 1015-2423
Pfiffner, L. (2013): Dossier Regenwurm - Die Plattform Schweizer Biobäuerinnen und Biobauern. hrsg. v. Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) [online]. zu finden in (http://www.bioaktuell.ch/de/pflanzenbau/biodiversitaet/regenwurm.html)
Römbke J et al. (2002): Entwicklung von biologischen Bodengüteklassen für Acker- und Grünlandstandorte. Berlin : Umweltbundesamt, 273 p., ISSN 0722-186X
Römbke, J. et al. (1997): Boden als Lebensraum für Bodenorganismen [online]. Karlsruhe, zu finden in http://www.fachdokumente.lubw.baden-wuerttemberg.de
Spiegel, A.-K. (2011): Auszeichnung für den Regenwurm - Thema des Monats 01/2011 [online].
Stöven, K., Schnug, E. (2009): Long term effects of heavy metal enriched sewage sludge disposal in agriculture on soil biota. Landbauforsch Volk, 59, 131-8 [online]. zu finden unter https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/bitv/dk041905.pdf
Topp, W. (1981) Biologie der Bodenorganismen. Heidelberg : Quelle und Meyer, 224 p, UTB 1101, ISBN 3-494-0219-5
Vetter, F. (2003): Regenwurm: Führer zur Ausstellung. Natur-Museum Luzern [online]. zu finden in
http://www.regenwurm.ch/files/downloadfiles/DOWNLOADS/broschrw1.pdf (PDF, 1,2 MB nicht barrierefrei)
http://www.regenwurm.ch/files/downloadfiles/DOWNLOADS/broschrw2.pdf (PDF, 1 MB, nicht barrierefrei)