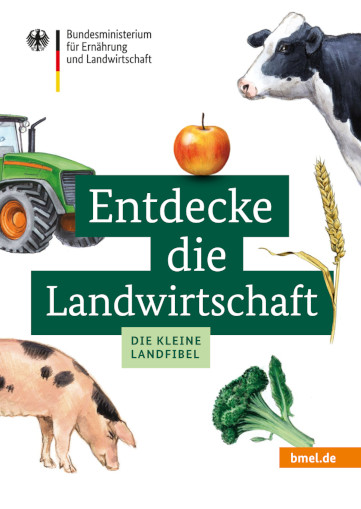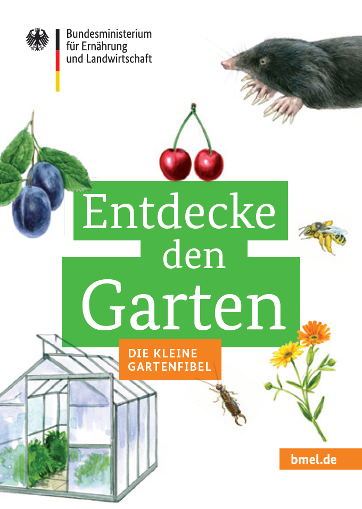Torfverwendung reduzieren – Klima schützen
Der Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung sieht Maßnahmen vor, mit denen die Verwendung von Torf verringert werden soll. Hintergrund ist, dass in Moorböden in vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden Kohlenstoff gebunden wurde. Wird der Rohstoff Torf den Mooren entnommen und genutzt, setzt er CO₂ frei, das die Klimakrise weiter antreibt.
Welche Maßnahmen sind geplant?
Damit die CO₂-Konzentration in der Atmosphäre nicht noch weiter steigt, führt der Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung folgende Maßnahmen mit Blick auf den Torfeinsatz in Deutschland auf:
- Der Einsatz von Torfen im Hobbygartenbau sowie im Garten- und Landschaftsbau soll durch Fachinformationen und Informationsmaßnahmen stark vermindert werden.
- Die Bundesregierung hat Vorgaben zur Verwendung von Torfersatzstoffen in den Vergaberichtlinien des Bundes für öffentliche Aufträge im Garten- und Landschaftsbau umgesetzt.
- Das BMEL stößt Informationsmaßnahmen zur Nutzung von Torfersatzstoffen im Gartenbau an.
- Das BMEL unterstützt Forschungsvorhaben zu Torfersatzstoffen.
Im Klimaschutzprogramm 2030 hat sich die Bundesregierung verpflichtet darauf hinzuwirken, dass im Freizeitgartenbau auf den Einsatz von Torf in den kommenden Jahren nahezu vollständig verzichtet wird. Angestrebt wird der vollständige Verzicht bis 2026. Im Erwerbsgartenbau soll bis zum Ende des Jahrzehnts ein weitgehender Ersatz von Torf stattfinden. Ausgangspunkt aller Bemühungen ist der freiwillige Verzicht aller Beteiligten (Erdenindustrie, Erwerbs- und Hobbygartenbau) auf Torf.
Der Koalitionsvertrag sieht vor, Alternativen zur Torfnutzung zu entwickeln und einen Ausstiegsplan für Torfabbau und –verwendung zu beschließen.
Wie viel Torf wird in Deutschland genutzt?
Aus der amtlichen Statistik liegen bislang keine ausreichend belastbaren Zahlen zur Torfgewinnung und zur Ein- und Ausfuhr von Torf in/nach Deutschland vor. Daher wird auf Zahlen des Industrieverbandes Garten e.V. (IVG) zurückgegriffen: Danach werden auf weniger als 8.000 Hektar jährlich Torf abgebaut (Torfvorkommen). Der überwiegende Teil des deutschen Torfs stammt aus Niedersachen. Die Gewinnungsmengen von Torf unterliegen stärkeren Schwankungen – 2005 wurden in Deutschland jährlich noch etwa 8 Millionen Kubikmeter Torf abgebaut. Bis 2019 reduzierte sich die Abbaumenge aus deutschen Lagerstätten auf 4,7 Millionen Kubikmeter (Gewinnungsmengen und Importe). Der Anteil an verarbeitetem, in Deutschland abgebautem Torf nimmt stetig ab. Der nach wie vor hohe Bedarf an Torf wird von der Erdenindustrie durch Importe, insbesondere aus dem Baltikum, gedeckt.
Wo kommen Substrate zum Einsatz?
Laut IVG wurden 2023 in Deutschland ca. 7,9 Millionen Kubikmeter Substrate abgesetzt. Für den deutschen Markt produzierte die Substratindustrie etwa 1,8 Millionen Kubikmeter Kultursubstrate für den Erwerbsgartenbau und etwa 4,0 Millionen Kubikmeter Blumenerden für Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner. Bei den Kultursubstraten für den Erwerbsgartenbau hatten 2023 nach Angaben der substratherstellenden Industrie andere Ausgangsstoffe als Torf einen Anteil von 27 Prozent, bei den Blumenerden für den Hobbybereich einen Anteil von bis zu 41 Prozent. Alternative Ausgangsstoffe mit bedeutenden Anteilen an der Substratherstellung sind Grünkompost (ca. 1.530.000 Kubikmeter pro Jahr), Holzfaser/Holz (ca. 887.000 Kubikmeter pro Jahr), Rindenhumus (ca. 270.000Kubikmeter pro Jahr), Kokosprodukte (ca. 130.000 Kubikmeter pro Jahr), sonstige organische Ausgangsstoffe, wie Pinienrinde, Holz oder Holzkompost (112.000 Kubikmeter pro Jahr) und mineralische Ausgangsstoffe, wie bspw. Perlite, Ton oder Blähton (191.000 Kubikmeter pro Jahr). Infos zu Ausgangsstoffen für Substrate.
Informationen zur Verfügbarkeit von alternativen Torfausgangsstoffen in Europa finden Sie im Arbeitspapier des Thünen-Institut (auf Englisch).
Welchen Beitrag leistet die Wissenschaft?
Wissenschaftler forschen seit mehr als 30 Jahren an Stoffen, die Torf ersetzen oder seinen Anteil reduzieren können. Die heute erhältlichen Torfersatzstoffe reichen in der Hobbygärtnerei aus, um den Einsatz von Torf vollständig oder größtenteils zu ersetzen.
Im professionellen Gartenbau sind die Herausforderungen für den Ersatz von Torf etwas größer. Dies liegt insbesondere daran, dass eine torfreduzierte Produktion Prozessanpassungen erfordert. Zudem können insbesondere in der Umstellungsphase höhere Produktionskosten im Vergleich zur Verwendung der herkömmlichen torfbasierten Substrate entstehen. Diese ergeben sich durch höhere Substratkosten, anfangs häufiger durchgeführte Substratanalysen sowie unter Umständen einem abweichenden Bedarf an Bewässerung, Düngung und Pflanzenschutz. Zudem gehen die Praxisbetriebe von einem höheren Kulturrisiko aus. Erste Praxisberichte zeigen, dass die Umstellung auf ein Substrat mit einem Anteil von bis zu 50% Torfersatzstoffen ohne immense Kostensteigerungen bei gutem bis sehr gutem Kulturerfolg machbar ist.
Wie setzt sich das BMEL für eine Verringerung der Torfverwendung ein?
Die Entwicklung von Torfalternativen ist ein zentraler Aspekt der Maßnahmen. Das BMEL arbeitet mit einem Mix von Maßnahmen daran, Torf in Blumenerden und Substraten zu ersetzen: Das BMEL fördert deutschlandweit Forschungs- und Entwicklungsprojekte aber auch Modell- und Demonstrationsvorhaben, in denen Betriebe intensiv dabei unterstützt werden, auf torfreduzierte Substrate umzustellen. Darüber hinaus sollen Fachstellen eingerichtet werden, die Gartenbetriebe während der gesamten Umstellungsphase individuell begleiten. Fach- und Verbraucherinformation zu den Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten von Torfersatzstoffen begleiten diese Maßnahmen.
Forschung und Entwicklung zu nachhaltigen Torfersatzstoffen
Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) fördert im Auftrag des BMEL Vorhaben zur nachhaltigen Erzeugung, Aufbereitung und Bereitstellung von Torfersatzstoffen. Im Rahmen des Förderprogramms Nachwachsende Rohstoffe werden bereits seit 2004 Projekte zur alternativen Nutzung von degenerierten Hochmoorflächen gefördert. Dabei wird erforscht, wie ein ökonomisch und ökologisch sinnvoller Anbau von Torfmoosen auf wiedervernässten Moorflächen als nachwachsender Rohstoff zur Produktion von Kultursubstraten ermöglicht werden kann. Weitere Ausgangsstoffe umfassen Rohrkolben, Faserpflanzen sowie Laub- und Nadelhölzer, welche durch unterschiedliche Verfahrensschritte zur Erhöhung der pflanzenbaulichen Eignung aufbereitet werden. Die Entwicklung torffreier Deckerden für Kulturpilze und Untersuchungen zu Schadsymptomen beim ökologischen Anbau von Topfkräutern sind weitere geförderte Vorhaben.
Die Charakterisierung von Qualitätsparametern und Eigenschaften wie Nährstoffeffizienz, Anpassungsfähigkeit, Ertragsfähigkeit und Ertragsstabilität sowie die Auswirkungen der Torfminderung auf die Kulturführung und begleitende ökonomische und ökologische Bewertungen werden im geförderten Verbundvorhaben ToPGa „Entwicklung und Bewertung von torfreduzierten Produktionssystemen im Gartenbau“ (Laufzeit 01.11.2021 bis 31.10.2024, Koordination Julius-Kühn-Institut) untersucht. Anhand von Modellkulturen werden Wechselwirkungen von Torfersatzstoffen in Kultursubstraten untersucht.
Modell- und Demonstrationsvorhaben
Modell- und Demonstrationsvorhaben TerZ "Einsatz torfreduzierter Substrate im Zierpflanzenbau"
Um den großflächigen Einsatz torfreduzierter Substrate im Zierpflanzenbau zu ermöglichen und regionale Lösungskonzepte aufzuzeigen, förderte die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) im Auftrag des BMEL ein entsprechendes Modell- und Demonstrationsvorhaben. Die Gesamtkoordination des Verbundes hat die Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Ahlem inne. TerZ lief vom 01.04.2019 bis 31.03.2023. Ein Nachfolgeprojekt ist gerade angelaufen.
Die Durchführung des Vorhabens erfolgt beispielhaft in fünf für den deutschen Zierpflanzenbau bedeutenden Regionen – sogenannten Modellregionen. In jeder Region werden drei bis fünf Demonstrationsbetriebe im Zierpflanzenbau bei der Umstellung einzelner Kulturen auf torfreduzierte Substrate durch regionale Koordinatoren begleitet. Im Zentrum des Vorhabens steht ein intensiver Wissenstransfer, um die Erkenntnisse und Ergebnisse aus dem Vorhaben einer breiten Fachöffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, diese zu sensibilisieren und möglichst viele Betriebe von einer Reduktion des Torfanteils im Pflanzsubstrat zu überzeugen. Im Oktober 2021 haben bereits 22 von 24 Gartenbaubetrieben das Projektziel erreicht und kultivieren mit maximal 50 Vol % Torf in ihrem Kultursubstrat erfolgreich und ohne dass dies zu größerem Mehraufwand geführt hätte. Die genutzten Torfersatzstoffe erfordern eine Umstellung und Anpassung der Kulturführung, um ein optimales Pflanzenergebnis zu erzielen. Zu den Aufgaben der Modellbetriebe gehört also eine Änderung der internen Betriebsabläufe.
Modell- und Demonstrationsvorhaben ToSBa zur Praxiseinführung von torfreduzierten Substraten in Baumschulen
Im Rahmen eines weiteren Modell- und Demonstrationsvorhabens ToSBa sollte gezeigt werden, wie Baumschulcontainergehölze in der Praxis ohne Qualitätseinbußen in stark torfreduzierten Substraten kultiviert werden können. Das von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) im Auftrag des BMEL geförderte Vorhaben hatte eine Laufzeit vom 01.08.2020 bis 31.07.2024 und wurde von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Bad Zwischenahn koordiniert. Im ersten Jahr konnte in fast allen Kulturen eine gute bis sehr gute Pflanzenqualität erzielt werden. Die ersten Erfahrungen zur Praxiseinführung torfreduzierter Substrate in Baumschulen zeigen, dass eine schrittweise Reduktion des Torfanteils in den Substraten empfehlenswert ist. Zudem sollten die Ansprüche der jeweiligen Kultur bei der Zusammenstellung des Substrates Beachtung finden (z.B. regelmäßige, begleitende Substratuntersuchungen durchgeführt werden. Auch für dieses erfolgreich verlaufene Modell- und Demonstrationsvorhaben wurde ein Nachfolgeprojekt beantragt, das vor kurzem genehmigt wurde.
Modell- und Demonstrationsvorhaben HOT "Hobby-Gartenbau mit torfreduzierten und torffreien Substraten auf Basis nachwachsender Rohstoffe"
Ziel des durch die FNR, im Auftrag des BMEL, geförderten Verbundvorhabens ist es, den Ersatz von Torf im Hobbygartenbau durch torfreduzierte und torffreie Substrate auf Basis nachwachsender Rohstoffe zu beschleunigen. Gezielte Schulungen von Verkaufspersonal, Schaupflanzungen und Online- Fortbildungen sollen die Verwendung von torffreien Substraten für Hobbygärtner erleichtern. Mithilfe von Reallaboren werden Erfahrungen der Verbraucher gesammelt und ausgewertet. Die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen koordiniert das Verbundvorhaben mit einer Laufzeit vom 01.02.2022 bis 31.03.2025.
Modell- und Demonstrationsvorhaben Friedhofsgartenbau
Ein kleines Vorhaben, welches sich mit den Herausforderungen der Torfreduktion im Friedhofsgartenbau beschäftigt, befindet sich in Vorbereitung.
Entwicklung eines Zertifizierungssystems für Torfersatzstoffe
Die "Meo Carbon Solutions GmbH" entwickelt und implementiert ein Zertifizierungssystem für Torfersatzstoffe. Dabei werden die Aspekte Ökologie (Waldrodung, Ressourcenübernutzung), soziale Nachhaltigkeit (Kinderarbeit und lokale Produktionsstandards) sowie Klimaschutz (Emissionsminderung gegenüber Torf) betrachtet und bewertet. Nach Analyse der Torfersatzstoff-Märkte und den entsprechenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt in einem Multi-Stakeholder-Ansatz die Entwicklung eines Konzepts für die Zertifizierung. Daran beteiligt sind Umwelt- und soziale Organisationen, Wissenschaft, Substrat- und Komponentenhersteller sowie Zertifizierungsstellen. Danach wird der Ansatz auf seine Praxistauglichkeit überprüft und optimiert, um schlussendlich bis 2026 eine Zertifizierung zu etablieren.
Kulturbegleitende fachliche Unterstützung der Gartenbaubetriebe
Ein in der Vorbereitung befindliches Verbundvorhaben zur Fachinformation zum Einsatz torfreduzierter und torffreier Substrate im Erwerbsgartenbau soll Wissenslücken in Gartenbaubetrieben schließen und die Ergebnisse aus Modell- und Demonstrationsvorhaben in die Praxis bringen. Dazu sollen Fachstellen an bestehenden Institutionen eingerichtet werden, welche Gartenbaubetriebe kulturbegleitend fachlich unterstützen.
Förderung von Nachwuchswissenschaftlern an deutschen Hochschulen
Um die Forschungskapazitäten der deutschen Hochschulen im Bereich Torfminderung auch für die Zukunft sicherzustellen und weiterhin zu stärken, wird eine Förderung von Nachwuchsforschern angestrebt. Die Förderung soll in den Bereichen Erzeugung und Aufbereitung von Torfersatzstoffen, der Entwicklung und Verwendung torfreduzierter und torffreier Kultursubstrate auf Basis nachwachsender Rohstoffe und hinsichtlich der Bewertung von Qualität, Nachhaltigkeit und Ökobilanzen eingesetzt werden.
Weiterführende Informationen zu Torfersatzstoffen, Fördermöglichkeiten und Veranstaltungshinweise sowie eine Projektdatenbank u.v.m. sind in dem Themenweb der FNR hinterlegt: https://torfersatz.fnr.de
Weitere Informationen
- Torffrei gärtnern, Klima schützen - Die Torfminderungsstrategie des BMEL (PDF, 793KB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm)
- Going peat-free, protecting the climate (PDF, 2MB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm)
- Der Klimaschutzplan 2050 - Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der Bundesregierung
- Klimaschutzprogramm 2030
- Koalitionsvertrag der 20. Legislaturperiode
- Modell- und Demonstrationsvorhaben "Einsatz torfreduzierter Substrate im Zierpflanzenbau"
- Projektdatenblatt "Torfmoose als Torfersatz" (PDF, 1MB, Datei ist nicht barrierefrei)
- Modell- und Demonstrationsvorhaben "Torfreduzierte Substrate in Baumschulen" ("TosBa")