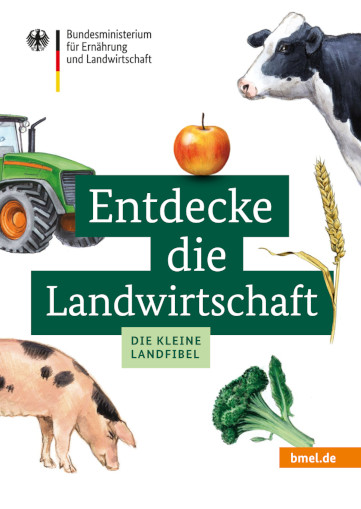Je kleiner die Herkunft, desto höher die Qualität
In den großen Weinbau treibenden Ländern Frankreich und Italien sowie im EU-Recht spielt die Herkunft von Weinen schon länger eine große Rolle. Nun ist das auch in Deutschland der Fall: Der stärkere Fokus auf die Herkunft ist zentraler Bestandteil der jüngsten Reform von Weinverordnung und Weingesetz.
Mit der letzten großen Reform der EU-Weinmarktorganisation im Jahr 2008 wurde u. a. die bis dahin bestehende Gleichwertigkeit des germanischen Qualitätsweinsystems mit dem romanischen Herkunftsansatz (Appellation d’Origine Contrôlée) aufgehoben und das Herkunftsmodell zum alleinigen Maßstab erhoben. Das machte eine Reform des von Teilen des nationalen Weinrechts notwendig, die nun abgeschlossen ist.
Der Bundesrat hat dem Entwurf zur Änderung der Weinverordnung am 26. März 2021 nach Maßgabe zugestimmt. Am 7. Mai 2021 erfolgte die Verkündung im Bundesgesetzblatt. Die Änderung des Weingesetzes war bereits im Januar 2021 in Kraft getreten. Ein stärkerer Fokus auf die Herkunft der Weine hat nunmehr auch Eingang in das nationale Recht gefunden.


Die mit der Änderung der Weinverordnung geschaffene Herkunftspyramide ist die wesentliche Änderung der Weinverordnung und folgt dem Grundsatz "je kleiner die Herkunft, desto höher die Qualität".
Basis der Pyramide ist der "Deutsche Wein", als Wein ohne geografische Angabe. Darüber folgt Wein mit geschützter geografischer Angabe gefolgt von Weinen mit geschützter Ursprungsbezeichnung. Diese Kategorie unterteilt sich wiederum in Weine aus einer Großlage, Weine die einen Orts- oder Gemeindenamen tragen und – an der Spitze – den Einzellageweinen.
Bei der Herkunftsstufe der geschützten Ursprungsbezeichnung (Anbaugebiet) bleibt der Status quo erhalten. Strengere rechtliche Vorschriften als bisher gelten nur in den beiden obersten Stufen (Orts- und Lagenweine). Bei den Ortsweinen gibt es Mindestvorgaben beim Mostgewicht und zu den Vermarktungsterminen. Bei Lageweine kommen noch Einschränkungen bei den Rebsorten hinzu. Die Schutzgemeinschaften können darüber hinaus zusätzliche Kriterien anwenden oder auch über die gesetzlich vorgegebenen Mindestvoraussetzungen hinausgehen.
Inhalt der Weingesetz-Reform
Bereits mit der Novelle des Weingesetzes, die im Januar dieses Jahres in Kraft getreten ist, wurden die Neuanpflanzungen für die Jahre 2021 bis 2023 auf jeweils 0,3 % der bestockten Rebfläche begrenzt und die Regelungen zum nationalen Stützungsprogramm mit dem Ziel einer besseren Mittelausschöpfung angepasst. Auf Bundesebene stehen nunmehr 2 Mio. € (bislang 1,5 Mio. €) für Absatzfördermaßnahmen auf dem Binnenmarkt und in Drittländern zur Verfügung.
Darüber hinaus wurden auch einige unionsrechtlich erforderlich gewordene Änderungen in Weingesetz und Weinverordnung vorgenommen.