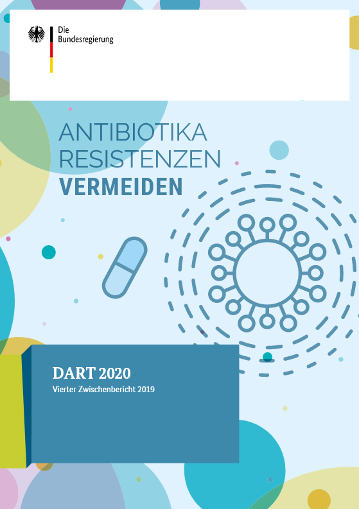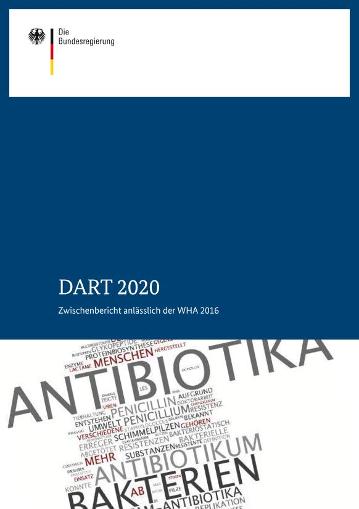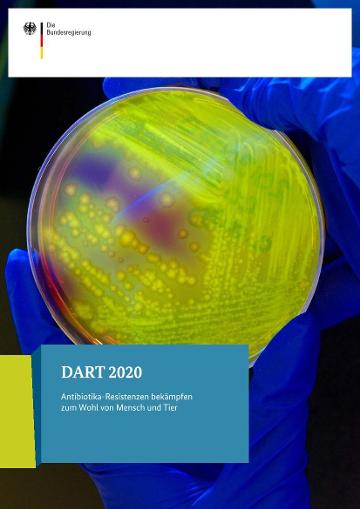Forschungsschwerpunkte zu Antibiotika-Resistenzen
Im Geschäftsbereich des BMEL beschäftigen sich verschiedene Einrichtungen mit Fragen zu Antibiotika-Resistenzphänomenen.
Forschungsprojekte im Auftrag des BMEL bzw. seiner nachgeordneten Einrichtungen und weiterer Institutionen der Bundesregierung werden im Überblick dargestellt.
Forschungsschwerpunkte des BfR
Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) stellt das Nationale Referenzlabor (NRL) "Antibiotika-Resistenzen für die Lebensmittelkette". Im BfR werden Standards für die Resistenzbestimmung entwickelt und Routinemethoden zur Diagnose von antibiotikaresistenten Bakterien verbessert.
Daneben betreut das BfR die Studie "VetCAb" (Veterinary Consumption of Antibiotics) die es im Rahmen seiner gesetzlichen Aufgaben in Auftrag gegeben hat. Wissenschaftler der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo) und der Universität Leipzig haben in einer Pilotstudie den Antibiotikaeinsatz an landwirtschaftlichen Nutztieren in Deutschland anhand einer repräsentativen Stichprobe über den Zeitraum von einem Jahr erfasst. VetCAb ist 2013 abgeschlossen worden.
Die Ergebnisse sollen unter anderem genutzt werden, um den Antibiotikaeinsatz in der Nutztierhaltung in Deutschland – auch im europäischen Vergleich – bewerten zu können. Zudem geben die Daten Hinweise, wie und an welchen Stellen der Antibiotikaeinsatz weiter reduziert werden kann.
Das Projekt VetCAb wird seit 2013 mit der Studie "VetCAb Sentinel" kontinuierlich durch die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover fortgesetzt, um beurteilen zu können, ob die in "VetCAb-Pilot" dokumentierten Antibiotika in ihrer eingesetzten Menge und Häufigkeit über einen längeren Zeitraum hinweg konstant bleiben oder sich über die Zeit verändern.
Forschungsschwerpunkte des BVL
Am Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) laufen Untersuchungen zum Antibiotika-Resistenzgeschehen tierpathogener Erreger bei klinisch erkrankten Tieren (Lebensmittel liefernde Tiere und "Hobby"-Tiere). Diese Erkenntnisse werden für die Beurteilung von Zulassungen von Antibiotika herangezogen und anonymisiert dem BfR für die Risikobewertung der Gesamtentwicklung zur Verfügung gestellt.
Forschungsschwerpunkte des FLI
Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) beschäftigt sich mit Fragen der Resistenzgene und Resistenzmechanismen in der Regel auf molekularer Ebene und erarbeitet Empfehlungen für die tägliche klinische Praxis.
Hier setzt das aktuelle Projekt des BMEL und des Forschungsverbunds aus der TU Berlin, der TiHo Hannover und dem Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Oldenburg zur Standardisierung der Antibiotika-Resistenzdiagnostik an. Ziel des Vorhabens ist die Erarbeitung von international anerkannten Durchführungsvorschriften zur quantitativen Empfindlichkeitsprüfung von zunächst sieben relevanten Erregergruppen gegen Antibiotika.
Die so erarbeiteten Daten zur Erregerempfindlichkeit stellen verlässliche Informationen für den behandelnden Tierarzt bei der Auswahl des sinnvollsten antimikrobiellen Wirkstoffes dar.
Das FLI will darüber hinaus Fragen zu molekularen Eigenschaften von MRSA klären, die Aufschluss über das Risikopotential und die potentiellen Fähigkeiten dieses Erregers zur Aufnahme von genetischem Fremdmaterial erbringen sollen.
Forschungsverbund RESET
Mit dem Forschungsverbund RESET, der seit November 2010 vom BMBF gefördert wird, sind verschiedene Institutionen beauftragt, die Verbreitung von Antibiotika-resistenten Bakterien zu erforschen. Schwerpunkt ist die Erforschung von Enterobakterien (Darmbakterien) wie Escherischia coli und Salmonella enterica bei Tieren und beim Menschen.
Hierbei geht es zum einen darum aufzuklären, wo und wie verbreitet welche resistenten Darmbakterien sind. Zum anderen geht es darum, zu beleuchten, ob und wie diese resistenten Bakterien vom Tier zum Menschen und umgekehrt gelangen, damit wirksame Angriffspunkte für Interventionsmaßnahmen identifiziert werden können.
Das BfR beteiligt sich mit zwei Projekten an dem nationalen Forschungsverbund RESET - Antibiotika-Resistenzen bei Tier und Mensch. Die Forschungsprojekte sind im Bereich Biologische Sicherheit im Nationalen Referenzlabor für Antibiotika-Resistenz und der Fachgruppe "Antibiotika-Resistenz und Resistenz-Determinanten" angesiedelt.
Forschungsverbund MedVet-Staph
Das Projekt MedVet-Staph ist ein Verbund von Veterinären, Naturwissenschaftlern, Humanmedizinern, Epidemiologen, Bioinformatikern sowie Experten für Risikosimulation und -bewertung. Ziel ist es, die Ausbreitung von zoonotischen MRSA einzudämmen und Präventions- und Kontrollstrategien zu entwickeln. Aus Forschungsergebnissen verschiedener Disziplinen sollen zudem Empfehlungen zur Eindämmung der Verbreitung von MRSA bei Tieren, im Lebensmittel und beim Menschen abgeleitet werden.
Forschungsförderung des BMEL
EsRAM
Das Forschungsvorhaben mit dem Titel "Entwicklung stufenübergreifender Reduktionsmaßnahmen für Antibiotikaresistente Erreger beim Mastgeflügel (EsRAM)" hat das Ziel, die Sicherheit von Geflügelfleischprodukten weiter zu verbessern, indem die Belastung durch antibiotikaresistente Erreger reduziert wird. Dazu werden einzelne Bereiche in der Geflügelprodukten betrachtet und neue und verbesserte Verfahren und Technologien entwickelt.
VASIB
Ziel des Forschungsprojekts "Verringerung des Einsatzes von Antibiotika in der Schweinehaltung durch Integration epidemiologischer Informationen aus klinischer, hygienischer, mikrobiologischer und pharmakologischer tierärztlicher Beratung (VASIB)" ist es, durch gezielte diagnostische Maßnahmen und Optimierung der Behandlungsstrategie sowie durch umfassende Managementberatungen der Landwirte den Einsatz von Antibiotika in der Nutztierhaltung und die damit einhergehende bakterielle Resistenzbildung zu reduzieren.
MRSA
Vier Forschungsprojekte zum Vorkommen von Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) bei Schweinen und anderen Tierarten fördert das BMEL seit 2009. Sowohl die FU Berlin (Tierhygiene) als auch TiHo Hannover versuchen aufzuklären, wie die so genannten "livestock associated MRSA" (den Tierbestand begleitende MRSA - LaMRSA) in die Bestände gelangen.
Aufbauend auf den Ergebnissen der europaweiten Studie bei Schweinen werden hierbei die Diagnostik überprüft und für die Routine optimiert. Zudem überprüfen die Wissenschaftler auch die Emissionen der Stallanlagen. Auch dieses Forschungskonsortium dient der Ergründung möglicher Ansatzpunkte für Maßnahmen, mit denen die Verbreitung minimiert werden kann.
Parallel wurde bis 2011 im Bundesprogramm ökologischer Landbau die Situation bei Schweinen untersucht, die ökologisch gehalten werden.
Ergebnisse der europaweiten MRSA-Studie bei Schweinen
- Analyse der Grundlagenstudie zur Erhebung der Prävalenz methicillinresistenter Staphylococcus aureus-Bakterien (MRSA) in Haltungsbetrieben mit Zuchtschweinbeständen in der EU im Jahre 2008
- Analyse der Grundlagenstudie zur Erhebung der Prävalenz methicillinresistenter Staphylococcus aureus-Bakterien (MRSA) in Haltungsbetrieben mit Zuchtschweinebeständen in der EU im Jahre 2008 [1] - Teil A: Schätzungen der MRSA-Prävalenz