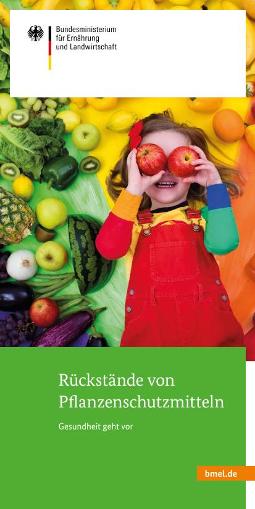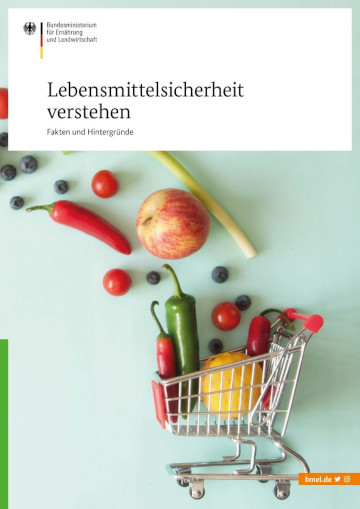Weniger trans-Fettsäuren in Lebensmitteln
Der Verzehr von trans-Fettsäuren in größeren Mengen kann sich ungünstig auf den Fettstoffwechsel auswirken und das Risiko für eine koronare Herzkrankheit steigern.
Trans-Fettsäuren entstehen vor allem bei der industriellen Fetthärtung von Pflanzenölen, wenn teilgehärtet wird. Dadurch wird die Textur und Stabilität der Öle verändert – sie werden streichfähig, weniger schnell ranzig und lassen sich aufgrund der geringeren Anfälligkeit für unerwünschte Oxidationsprozesse stärker erhitzen. Trans-Fettsäuren treten u. a. in Backmargarinen und Frittierölen und damit in fetthaltigen Backwaren oder frittierten Erzeugnissen auf. Natürlicherweise sind trans-Fettsäuren auch in Milchfett und Fleisch (bzw. im Depotfett von Wiederkäuern) enthalten. Ursache ist der Umbau von ungesättigten Fettsäuren durch Bakterien im Pansen von Wiederkäuern.
Gesundheitliche Bewertung von trans-Fettsäuren
Ein hoher Verzehr an trans-Fettsäuren kann sich ungünstig auf den Fettstoffwechsel auswirken und das Risiko für eine koronare Herzkrankheit erhöhen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt daher, die täglich zugeführte Menge an trans-Fettsäuren möglichst gering zu halten. Sie sollte weniger als ein Prozent der täglichen Nahrungsenergie ausmachen. In Deutschland liegt nach Einschätzung des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) die durchschnittliche Aufnahme deutlich unter diesem Wert.
EU-weiter Grenzwert für trans-Fettsäuren in Lebensmitteln
Die EU-Kommission hat mit der Verordnung (EU) Nr. 2019/649 vom 24. April 2019 einen verbindlichen EU-weit gültigen Grenzwert für andere trans-Fettsäuren als solche, die auf natürliche Weise in Fett tierischen Ursprungs vorkommen, festgelegt. Demnach dürfen in Lebensmitteln, die für den Endverbraucher und den Einzelhandel bestimmt sind, maximal 2 Gramm dieser sogenannten industriellen trans-Fettsäuren pro 100 Gramm Fett enthalten sein.
Für Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung gibt es ebenfalls eine Obergrenze gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2016/127: In diesen Erzeugnissen darf der Gehalt an trans-Fettsäuren 3 Prozent des gesamten Fettgehaltes nicht übersteigen. Dieser Wert trägt der Tatsache Rechnung, dass in diesen Lebensmitteln ein hoher Anteil an Milch mit natürlich vorhandenen trans-Fettsäuren enthalten ist.
Gemeinsame Initiative von BMEL und Lebensmittelwirtschaft
Bereits in der Vergangenheit führte das Bundesernährungsministerium einen Minimierungsdialog zu trans-Fettsäuren mit Wirtschaftsverbänden betroffener Branchen, der im Juni 2012 in einer gemeinsamen Initiative der Lebensmittelwirtschaft und des Bundesministeriums mündete. Dabei haben die Verbände unter wissenschaftlicher Beratung des Max Rubner-Instituts (MRI) eine Rahmenleitlinie sowie sieben spezifische Leitlinien für verschiedene Produktkategorien entwickelt. Die Leitlinien sollen die Hersteller für die Problematik sensibilisieren und bei der Umstellung auf trans-Fettsäure-arme Produkte Hilfestellung geben, um die Gehalte von trans-Fettsäuren in Lebensmitteln insgesamt weiter zu senken.
Produkt-Leitlinien zur Minimierung von Trans-Fettsäuren in Lebensmitteln
- Margarinen (PDF, 651KB, Datei ist nicht barrierefrei)
- Frittieröle (PDF, 619KB, Datei ist nicht barrierefrei)
- Siedeöle (PDF, 749KB, Datei ist nicht barrierefrei)
- Feine Backwaren (PDF, 345KB, Datei ist nicht barrierefrei)
- Knabberartikel (PDF, 335KB, Datei ist nicht barrierefrei)
- Kartoffelverarbeitungsprodukte (PDF, 252KB, Datei ist nicht barrierefrei)
- Tiefkühlpizzen (PDF, 310KB, Datei ist nicht barrierefrei)