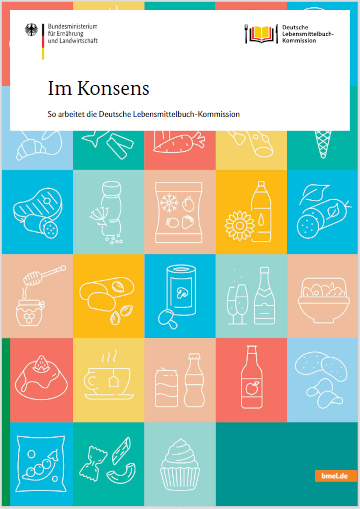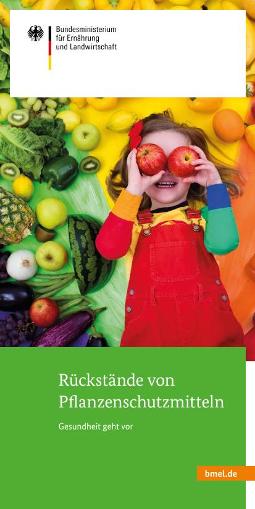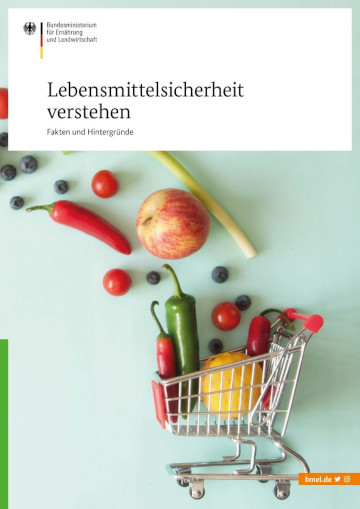Fragen und Antworten im Zusammenhang mit Fleisch- und Milchalternativen
Zu einigen Fragen, die im Zusammenhang mit Fleisch- und Milchalternativen gestellt werden, finden Sie hier Antworten.
Welche pflanzenbasierten alternativen Lebensmittel zu tierischen Erzeugnissen gibt es?
Auf den stetig wachsenden Markt von Lebensmitteln mit (überwiegend) pflanzlichen Zutaten als Alternative zu tierischen Erzeugnissen kann an dieser Stelle nur ein kleines Schlaglicht geworfen werden. Generell lässt sich unterscheiden zwischen
- Ersatzprodukten, die sich an tierische Lebensmitteln in Aussehen, Geschmack und Textur anlehnen, wie etwa vegane Würstchen, und
- solchen Produkten, die einen anderen Geschmack versprechen und das tierische Produkt nicht imitieren, beispielsweise Rote-Beete-Meerrettich-Aufstrich.
Ersatzprodukte für Fleisch und Wurstwaren basieren häufig auf Sojabohnen (Tofu, Tempeh und texturiertes Sojaprotein) und Weizeneiweiß (Seitan). Ebenfalls erhältlich sind Alternativen zu Fleisch auf Basis von Grünkern, Lupinen, Erbsen, Kichererbsen, Bohnen und Jackfrucht. Vegetarische Alternativen gibt es zudem auf Basis von Ei oder Milch. Alternativen zu Milch und Milchprodukten können auf Soja, Getreide (wie Hafer, Dinkel und Reis), Nüssen, Cashews, Mandeln, Lupinen, Kokosnüssen und Erbsen basieren.
Wie entsteht zellkulturbasiertes Fleisch (In-vitro-Fleisch)?
Für zellkulturbasiertes Fleisch werden Stammzellen eines Tieres, welche aus dem Muskelgewebe gewonnen werden, genutzt. Die Zellkulturen werden in einem Nährmedium in einem Behälter (Bioreaktor) vermehrt. Bei der Kultivierung durchlaufen die Zellen verschiedene Stadien und es entwickeln sich Muskelfasern. Über ein Trägergerüst, meist aus tierischem Kollagen, wachsen die Zellen zu einer größeren Masse zusammen. Auf diese Weise entstehen sehr dünne Fleischschichten. Die Masse ähnelt Hackfleisch. Rund 20.000 dieser Muskelzellen benötigt man für einen Burger. In ähnlicher Weise werden auch Fettzellen gezüchtet, die zusammen mit dem Muskelgewebe ein Erzeugnis ergeben sollen, das dem Geschmack von echtem Fleisch möglichst nahekommt.
In der Republik Singapur wurde im Dezember 2020 weltweit das erste Lebensmittel auf der Basis von Zellkulturen zugelassen. Es handelt sich um ein Hähnchennugget, das allerdings auch pflanzliche Proteine enthält. Zwischenzeitlich wurden in den USA und Israel Zulassungen erteilt. Es handelt sich jeweils um Hybridprodukte, die aus zellkultur-basiertem Fleisch und pflanzlichen Proteinen bestehen.
Ist für In-vitro-Fleisch eine Sicherheitsbewertung erforderlich?
Ja, vor einer EU-weit geltenden Zulassung muss die Sicherheit von In-vitro-Fleisch (zellkulturbasiertem Fleisch) bewertet werden. Zellkulturbasiertes Fleisch fällt unter das Recht über neuartige Lebensmittel (Novel Food) oder ggfs. das Gentechnikrecht (falls es aus einem gentechnisch veränderten Organismus besteht oder gewonnen wurde oder einen solchen enthält). In beiden Fällen ist der Ausschluss eines Sicherheitsrisikos Voraussetzung für die Zulassung des Lebensmittels.
Woher kommt das Soja für die Lebensmittel?
Sojabasierte Lebensmittel, die auf dem deutschen Markt angeboten wer-den, werden größtenteils aus gentechnikfreiem Soja aus europäischer Landwirtschaft hergestellt. Das BMEL fördert über seine Eiweißpflanzenstrategie den Anbau heimischen Sojas.
Warum heißen pflanzliche Alternativgetränke zu Milch nicht Milch, sondern Drink, und pflanzliche Alternativen zu Käse nicht Käse?
Pflanzliche Produkte dürfen nicht unter Milchbezeichnungen wie z. B. "Milch", "Rahm", "Butter", „Käse", "Molke", "Buttermilch" oder "Joghurt" vermarktet werden. Diese Bezeichnungen obliegen einem absoluten Bezeichnungsschutz und sind allein Erzeugnissen tierischen Ursprungs – konkret: der Eutersekretion von Säugetieren – vorbehalten.
Ausnahmen bilden traditionelle Erzeugnisse oder solche, bei denen der Name eine charakteristische Eigenschaft beschreibt – etwa Kokosmilch, Kakaobutter, Erdnussbutter oder Leberkäse. Dies stellte der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) in seinem Urteil vom 14. Juni 2017 – C-422/16 – klar (Verordnung (EU) Nr.1308/2013, Teil III, Nr. 1-3).
Warum gibt es bei Alternativen zu Fleisch und Wurst keine Bezeichnung wie "Thüringer Mett" oder "Salami"?
In Deutschland beschreiben die "Leitsätze für vegane und vegetarische Lebensmittel mit Ähnlichkeit zu Lebensmitteln tierischen Ursprungs" der Deutschen Lebensmittelbuch-Kommission, wie vegane und vegetarische Lebensmittel, die sich an Fleisch oder Fleischerzeugnissen anlehnen, hergestellt, bezeichnet und aufgemacht werden. Je intensiver die Anlehnung der Bezeichnung an das Vorbild tierischen Ursprungs ist, desto mehr muss es dem tierischen Original auch ähneln. Gattungsbezeichnungen wie "Würstchen" oder "Hack" sind daher auch für vegane und vegetarische Lebensmittel üblich, der Verweis auf Tierkörperteile wie "Filet" ist prinzipiell nicht gebräuchlich. Teilweise kann durch Erläuterungen auf das Alternativlebensmittel hingewiesen werden, z. B. durch den Zusatz "nach Art einer Salami". Üblich ist zudem, dass auf den veganen oder vegetarischen Charakter des Lebensmittels hingewiesen wird und die Hauptzutat genannt wird, z. B. "veganes Würstchen aus Erbsenprotein".
Woran erkenne ich rein pflanzliche oder vegetarische Lebensmittel?
Viele Lebensmittel sind vegan oder vegetarisch und auch als solche gekennzeichnet. Ist eine Irreführung der Verbraucherinnen und Verbraucher ausgeschlossen, kann der Hinweis auf die vegane oder vegetarische Eigenschaft auch entbehrlich sein. In denjenigen Fällen wird die Kenntlichmachung als "vegan" oder "vegetarisch" jedoch zur Pflicht wird, wenn andernfalls eine Irreführung der Verbraucherinnen und Verbraucher über die tatsächliche Beschaffenheit des Lebensmittels droht.
ie immer hilft der Blick auf die Bezeichnung des Lebensmittels und das Zutatenverzeichnis.
Mehr Informationen zu veganen und vegetarischen Lebensmitteln den finden Sie auch hier.
Wieviel Protein pro Tag benötige ich und kann ich diesen Bedarf auch allein mit pflanzlicher Ernährung decken?
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt eine Zufuhr von 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag bei Erwachsenen bis unter 65 Jahren. Dies entspricht, bezogen auf das Referenzgewicht, je nach Alter und Geschlecht, einer Zufuhr von 47 bis 57 Gramm Protein pro Tag. Erwachsene ab 65 Jahren sollten 1 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht und Tag zum Erhalt der Körperfunktionen zu sich nehmen. Diese Menge kann über den Verzehr proteinreicher Lebensmittel erreicht werden. Wer sich nur für pflanzliche Produkte entscheidet kann auf Hülsenfrüchte wie Soja, Linsen und Erbsen, aber auch auf Nüsse und Saaten zurückgreifen. Auch Getreideprodukte wie Brot tragen zur Versorgung mit Protein bei.
Pflanzliche und tierische Proteine unterscheiden sich in der Zusammensetzung und in der Bioverfügbarkeit der Aminosäuren, den Grundbausteinen der Proteine. Proteine aus Lebensmitteln tierischen Ursprungs enthalten i.d.R. alle unentbehrlichen Aminosäuren ins ausreichender Menge in Bezug zum Bedarf. Pflanzliche Lebensmittel weisen häufig nicht das volle Spektrum dieser unentbehrlichen Aminosäuren auf. Durch die gezielte Kombination von z. B. Getreide mit Hülsenfrüchten, wie bei Linsen-gemüse mit Reis oder Erbseneintopf mit Brot, kann dies komplett ausgeglichen werden.
Weitere Informationen finden Sie hier.