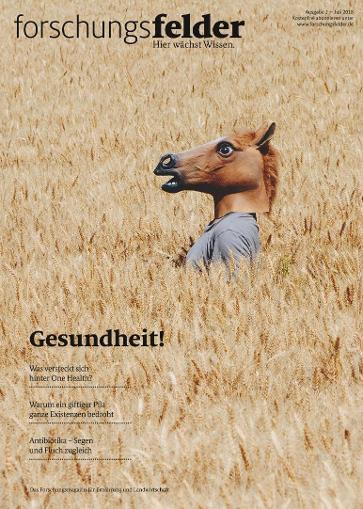Fragen und Antworten zu BSE: Allgemeines
Was ist BSE?
BSE (Bovine Spongiforme Enzephalopathie, zu deutsch: schwammartige Hirnkrankheit des Rindes) ist eine Erkrankung bei Rindern mit Veränderungen des Gehirns, die letztlich zum Tod der Tiere führt. Die Krankheit wurde erstmals 1986 im Vereinigten Königreich beschrieben. Als Ursache der Krankheit werden infektiöse Proteine (Prionen) angenommen. Nach dem aktuellen Stand der Forschung sind Prionen infektiöse Eiweißpartikel, die aus einer fehlgefalteten Form des wirtseigenen Prionproteins bestehen.
Rinder, die an BSE erkrankt sind, zeigen Verhaltensänderungen, wie Nervosität, Ängstlichkeit und Schreckhaftigkeit, Bewegungsstörungen und Koordinationsschwierigkeiten. Zudem reagieren sie überempfindlich auf Berührung, Lärm und Licht.
Was ist atypische BSE?
Neben der klassischen BSE-Form werden seit 2004 vereinzelt Fälle von atypischer BSE festgestellt. Man unterscheidet zwei verschiedene Formen der atypischen BSE (H-Typ und L-Typ), die sich in ihren biologischen Eigenschaften und den biologischen Charakteristika des krankmachenden Proteins voneinander und von der klassischen BSE unterscheiden.
Die Krankheitssymptome sind die gleichen wie bei der klassischen BSE-Form. Ob es sich um die atypische Form handelt, lässt sich erst mit labordiagnostischen Methoden feststellen.
Beide atypischen BSE-Formen wurden bisher überwiegend bei Rindern diagnostiziert, die älter als acht Jahre waren.
Aufgrund epidemiologischer Daten, weltweites Auftreten mit sehr niedriger Fallzahl bei älteren Tieren und der Tatsache, dass kein Zusammenhang zwischen den einzelnen Fällen besteht, wird vermutet, dass atypische BSE-Fälle spontan entstehen. Es ist daher anzunehmen, dass Einzelfälle von atypischer BSE auch in Zukunft vorkommen werden. Insgesamt ist die Erkenntnislage zur atypischen BSE aber noch sehr lückenhaft.
Wie wird BSE übertragen?
Hauptursache für die Übertragung der Krankheit ist nach derzeitigen Erkenntnisstand die Verfütterung von kontaminiertem Fleisch- und Knochenmehl. Die Wiederverwertung von infiziertem Ausgangsmaterial von Schafen (Scrapie) und später von Rindern, das an Rinder verfüttert wurde, hat im Vereinigten Königreich in den achtziger Jahren in Verbindung mit einer Änderung des Herstellungsverfahrens bei Fleisch- und Knochenmehl die BSE-Erkrankungen ausgelöst. Diese Änderung bestand unter anderem in einer Senkung der Verarbeitungstemperatur, so dass die BSE- und Scrapie-Erreger beim Produktionsprozess nicht inaktiviert wurden. Solche nach EU-Recht zulässigen alternativen Erhitzungsverfahren führten nicht zu einer ausreichenden Inaktivierung des BSE-Agens. Bei den in Deutschland aufgetretenen BSE-Fällen könnte die Infektion auf Milchaustauschfutter zurückzuführen sein. Dies bedeutet nicht, dass die Milchkomponente des Futtermittels hierfür verantwortlich ist. Vielmehr wäre zu vermuten, dass dem Milchaustauschfutter zugemischte sonstige tierische Eiweiße oder Fett aus Tierkörperbeseitigungsanstalten ursächlich sein könnten. Mittlerweile liegen auch Hinweise dafür vor, dass bei BSE eine vertikale Übertragung, das heißt vom Muttertier auf ihr Kalb, stattfinden kann. BSE wird nach derzeitigem wissenschaftlichen Kenntnisstand nicht durch Kontakte zwischen kranken und gesunden Tieren übertragen. Für eine Übertragung über Rindersperma gibt es keine Hinweise.
Gibt es einen sicheren Schutz vor BSE?
Einen 100-prozentigen Schutz kann niemand garantieren. Das Risiko wird aber durch verschiedene BSE-Schutzmaßnahmen minimiert. So wird das BSE-Risikomaterial (siehe nächste Frage) bei der Schlachtung der Tiere entfernt. Es gilt ein Verfütterungsverbot von Futtermitteln, die verarbeitetes tierisches Protein enthalten, an Wiederkäuer. Eine weitere wichtige Vorkehrung zum Schutz vor BSE ist die Testung sämtlicher Risikotiere. Durch Kombination dieser und anderer Maßnahmen wird nach dem Stand der Wissenschaft der gesundheitliche Verbraucherschutz gewährleistet.
BSE: Welche Teile von Wiederkäuern werden als Risikomaterial eingestuft?
Aufgrund der Ergebnisse von Infektionsversuchen können bestimmte Teile von Wiederkäuern als spezifizierte Risikomaterialien eingestuft werden. Hierzu zählen insbesondere der Schädel mit Hirn und Augen und das Rückenmark von über zwölf Monate alten Rindern, die Wirbelsäule bei Rindern im Alter von über 30 Monaten sowie die Mandeln, die letzten vier Meter des Dünndarms, der Blinddarm und das Darmgekröse von Rindern aller Altersklassen. Bei Rindern aus Mitgliedstaaten mit vernachlässigbarem BSE-Risiko gelten nur der Schädel ohne Unterkiefer, einschließlich Gehirn und Augen, und das Rückenmark von über zwölf Monate alten Rindern als spezifizierte Risikomaterialien. Deutschland hat am 6. Juli 2016 den Status "vernachlässigbares Risiko" erhalten.
Bei Schafen und Ziegen jeden Alters gelten bei über zwölf Monate alten Tieren der Schädel mit Gehirn und Augen und das Rückenmark als Risikomaterial. Die Risikomaterialien müssen bei der Schlachtung entfernt und beseitigt werden.
Die Liste der Risikomaterialien wird fortlaufend an den neusten wissenschaftlichen Kenntnisstand angepasst.
Mit Muskelfleisch und Milch von an BSE erkrankten Rindern konnten in Tierversuchen mit Mäusen und Kälbern keine Infektion ausgelöst werden. Bislang gibt es keine Hinweise, dass mit Muskelfleisch von Rindern, die an BSE erkrankt waren, eine Infektion ausgelöst werden kann.
Wie sicher sind die BSE-Schnelltests?
Mit Hilfe der BSE-Schnelltests können die krankhaft veränderten Prionen in Gehirnproben von geschlachteten Rindern nachgewiesen werden. Für Blut, Fleisch oder Milch sind diese Tests ungeeignet. Die derzeit eingesetzten Testverfahren sind nur bei Tieren sicher, bei denen das Infektionsgeschehen so weit fortgeschritten ist, dass genügend Erreger für die Nachweisbarkeit mit diesen Tests vorliegen. Dies ist in der Regel erst bei älteren Tieren der Fall. Auch Fälle atypischer BSE werden mit den eingesetzten BSE-Schnelltests detektiert. Bei positivem oder zweifelhaftem Ergebnis eines Schnelltests werden erheblich aufwendigere Bestätigungsuntersuchungen im jeweiligen nationalen Referenzlaboratorium durchgeführt. In Deutschland erfolgen diese Untersuchungen im Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit.
Wann werden BSE-Schnelltests eingesetzt?
In Deutschland werden derzeit sämtliche Risikotiere, das heißt alle
- BSE-Verdachtsfälle
- über 48 Monate alten wegen einer Verletzung notgeschlachteten Rinder sowie
- über 48 Monate alten verendeten Rinder getestet.
Die EU-Mitgliedstaaten wurden ermächtigt, nach der Entscheidung 719/2009 ihr Überwachungssystem zu überarbeiten. Grundlage hierfür war eine befürwortende wissenschaftliche Stellungnahme.
Demnach bestand seit März 2013 die Möglichkeit für Deutschland bei gesund geschlachteten Rindern gänzlich auf BSE-Tests zu verzichten.
Mit der Verordnung vom 21. April 2015 (BGBl. I S. 615) wurde die BSE-Untersuchungsverordnung aufgehoben. Damit entfällt mit Wirkung vom 28. April 2015 national die verpflichtende systematische Untersuchung der gesund geschlachteten Rinder auf BSE.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit und BSE?
Die britischen Behörden erklärten am 20. März 1996, dass ein Zusammenhang zwischen BSE und der neuen Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit nicht ausgeschlossen werden könne. In Großbritannien hat es die meisten Fälle von BSE bei Rindern und auch die häufigsten Fälle der neuen Variante von Creutzfeldt-Jakob gegeben. Zoonotische Infektionen mit Erregern der BSE werden damit in Verbindung gebracht. Infolge der BSE-Epidemie haben BSE-Prionen als zuvor unbekannte Krankheitserreger die Artengrenze zum Menschen übersprungen und Fälle der neuen Variante der Creutzfeld-Jakob-Krankheit beim Menschen verursacht. Die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit tritt beim Menschen nur sehr selten auf. Allerdings handelt es sich um eine unheilbare und tödlich verlaufende neurologische Erkrankung. Die neue Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit tritt vornehmlich bei jüngeren Personen auf. Die Krankheit verläuft oft langsamer und weist ein anderes klinisches Bild auf, als die klassische Creutzfeldt-Jakob-Krankheit.