Fragen und Antworten zu Jodsalz
Was ist Jod und warum ist es so wichtig?
Jod ist als lebenswichtiges Spurenelement unverzichtbar für die menschliche Gesundheit. Der Körper benötigt es, um normal zu funktionieren. Es ist Bestandteil der Schilddrüsenhormone, die zahlreiche Stoffwechselprozesse und den Wärmehaushalt regulieren sowie bei Kindern das Wachstum, deren Knochenreifung und Gehirnentwicklung maßgeblich beeinflussen. Ohne Jod kann die Schilddrüse nicht funktionieren, was eine Vielzahl von gesundheitlichen Problemen nach sich ziehen kann. Ein Jodmangel kann zur Bildung eines Kropfes (Vergrößerung der Schilddrüse), Schilddrüsenknoten und Schilddrüsenfunktionsstörungen führen. Eine Schilddrüsenunterfunktion äußert sich in unspezifischen Symptomen, z. B. Müdigkeit, mentale und körperliche Leistungsminderung, trockene und blasse Haut, brüchige Nägel, Konzentrationsstörungen, Appetitlosigkeit und Verstopfung. Die konsequente Nutzung von Jodsalz anstelle von nicht-jodiertem Tafelsalz trägt zu einer ausreichenden Jodversorgung bei.
Wie viel Jod sollte ich zu mir nehmen?
Der Jodbedarf einer Person ist unter anderem abhängig vom Alter und dem allgemeinen Gesundheitszustand. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) gibt Empfehlungen für die tägliche Jodzufuhr in Abhängigkeit vom Alter. Dabei reicht die Empfehlung von 40 Mikrogramm pro Tag (μg/Tag) bei Säuglingen in den ersten vier Monaten bis zu 200 μg/Tag für Jugendliche und Erwachsene. In der Schwangerschaft werden 230 μg/Tag, in der Stillzeit 260 μg/Tag empfohlen. Zum Vergleich: Zwei Scheiben eines mit Jodsalz hergestellten Brotes (100 Gramm) enthalten typischerweise etwa 20 bis 25 μg Jod, ein Glas Milch (250 Milliliter) oder eine Portion Rotbarsch (100 Gramm) liefern im Allgemeinen jeweils etwa 20 bis 40 μg Jod. Eine Portion Kabeljau (100 Gramm) kann über 200 μg Jod enthalten.
Kann ich zu viel Jod mit Jodsalz zu mir nehmen?
Die Jodmenge, die Speisesalz zugegeben werden darf, ist rechtlich geregelt und liegt derzeit bei 15 bis 25 Milligramm Jod pro Kilogramm Salz. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt Erwachsenen, eine langfristige tägliche Aufnahme von 500 μg Jod nicht zu überschreiten. Unter dieser Voraussetzung sind auch bei empfindlichen Personen keine gesundheitlichen Probleme zu erwarten. Modellrechnungen des Max Rubner-Institutes (Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel ) zeigen, dass selbst wenn alle verzehrten gesalzenen Lebensmittel (selbst zubereitete und verarbeitete) Jodsalz enthielten, mehr als 90 Prozent der Bevölkerung in Deutschland (14 bis 80 Jahre) die tolerierbare Gesamtaufnahme von 500 μg/Tag aus Lebensmitteln nicht überschreiten würden. Generell gilt: Jodsalz erleichtert eine ausreichende Jodversorgung. Trotzdem sollten Sie auf eine insgesamt moderate Salzzufuhr achten. Wenn Sie Salz zu sich nehmen, dann nutzen Sie Jodsalz .
Wieviel Salz sollte ich maximal täglich zu mir nehmen?
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt Erwachsenen, täglich nicht mehr als 6 Gramm Salz zu sich zu nehmen . Das entspricht circa einem Teelöffel Salz. Kindern und Jugendlichen wird in Abhängigkeit vom Alter eine maximale tägliche Salzzufuhr von 3 bis 6 Gramm empfohlen. Wichtig zu wissen: Das meiste Salz, das wir täglich zu uns nehmen, stammt aus verarbeiteten Lebensmitteln, vor allem Brot und Brötchen, Fleisch- und Wurstwaren sowie Käse.
Welche Symptome treten bei Jodmangel auf?
Die gesundheitlichen Folgen eines Jodmangels hängen davon ab, wie stark die Unterversorgung ist. Wenn man langfristig zu wenig Jod zu sich nimmt, kann sich die Schilddrüse vergrößern. Es bildet sich ein sogenannter "Kropf" (Struma), was mit der Bildung von Knoten in der Schilddrüse einhergehen kann. Damit verbunden kann eine Schilddrüsenunterfunktion auftreten. Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion können unter anderem Müdigkeit, Schwäche, mentale und körperliche Leistungsminderung, Gewichtszunahme, trockene und blasse Haut, brüchige Nägel und Appetitlosigkeit sein. Bei Kindern und Jugendlichen kann sich infolge einer Schilddrüsenunterfunktion außerdem eine verzögerte Entwicklung ergeben. Eine mögliche Funktionsstörung der Schilddrüse lässt sich durch eine Ärztin oder einen Arzt feststellen. Funktionsstörungen der Schilddrüse können neben Jodmangel auch andere Ursachen haben, z. B. eine Autoimmunerkrankung bzw. genetische Faktoren.
Wer sollte ganz besonders auf die Jodversorgung achten?
Aufgrund der geringen natürlichen Jodgehalte in den meisten Lebensmitteln in Deutschland sollte grundsätzlich jede und jeder auf eine ausreichende Jodversorgung achten. Ein erhöhter Jodbedarf besteht während Schwangerschaft und Stillzeit. Auch Frauen, die schwanger werden wollen oder könnten, sollten ein besonderes Augenmerk auf ihre Jodversorgung legen. Ebenso Menschen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren oder unter bestimmten Lebensmittelallergien oder -unverträglichkeiten leiden (Milch, Fisch und Meeresfrüchte, Eier). Im Kindes- und Jugendalter ist eine ausreichende Versorgung mit Jod ganz besonders wichtig für Wachstum und Entwicklung.
Woher weiß ich, ob ich ausreichend Jod aufnehme?
Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie schon genügend Jod zu sich nehmen, konsultieren Sie am besten eine Ärztin/einen Arzt oder eine Ernährungsfachkraft. Ob Sie ausreichend mit Jod versorgt sind und Ihre Schilddrüse normal funktioniert, kann im Allgemeinen über Ultraschall- und Blutuntersuchungen festgestellt werden. Mit Sonografie und Untersuchungen der Schilddrüsenhormone aus dem Blut sieht man die Folgen eines längere Zeit bestehenden Jodmangels. Ernährungsmediziner können aus Ernährungsprotokollen abschätzen, ob ausreichend Jod aufgenommen wurde.
Kann ich in der Schwangerschaft und Stillzeit weiterhin Jodsalz verwenden?
Ja. In der Schwangerschaft und Stillzeit haben Frauen einen erhöhten Jodbedarf. Das Netzwerk Gesund ins Leben empfiehlt daher neben einer ausgewogenen Ernährung mit Milch, Milchprodukten und Meeresfisch und der Verwendung von Jodsalz sowie von mit Jodsalz hergestellten Lebensmitteln die Einnahme von Jodtabletten in einer Dosis von 100 (bis 150) Mikrogramm Jod pro Tag, bei Schilddrüsenerkrankungen nach ärztlicher Rücksprache.
Muss ich bei Schilddrüsenerkrankungen auf Jodsalz und jodhaltige Lebensmittel verzichten?
Die Jodzufuhr im Rahmen der üblichen Ernährung stellt auch für Patientinnen und Patienten, die wegen einer Autoimmunerkrankung der Schilddrüse (Morbus Basedow oder Hashimoto-Thyreoiditis) behandelt werden, kein gesundheitliches Problem dar. Auch ist es für diese Personen gesundheitlich unbedenklich, wenn die Jodzufuhr durch den vermehrten Konsum von Jodsalz entsprechend den Zufuhrempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) auf 180 bis 200 Mikrogramm/Tag bei Erwachsenen gesteigert wird.
Zur Einordnung: Die DGE empfiehlt Erwachsenen eine Salzzufuhr von nicht mehr als 6 Gramm pro Tag. Sollten diese 6 Gramm zu 100 Prozent aus Jodsalz bestehen, würden damit durchschnittlich 120 Mikrogramm Jod aufgenommen werden. Die tägliche mediane Jodaufnahme aus Lebensmitteln ohne Berücksichtigung von jodiertem Speisesalz beträgt bei Erwachsenen in Deutschland wiederum laut Berechnungen der Universität Bonn knapp 74 Mikrogramm. Somit läge die Gesamtjodzufuhr auch bei Ausschöpfung der maximalen Salzzufuhrempfehlung und vollständiger Verwendung von Jodsalz anstelle von unjodiertem Salz im Durchschnitt im Bereich der Jodzufuhrempfehlung der DGE.
Es müssen demnach auch Personen mit einer Schilddrüsenüberfunktion nicht auf jodhaltige Lebensmittel wie Seefisch, Milch und Milchprodukte sowie jodiertes Speisesalz und damit hergestellte Produkte verzichten. Lediglich eine chronisch erhöhte Jodzufuhr von über 300 Mikrogramm/Tag kann hier die Entzündungsaktivität in der Schilddrüse triggern.
Demnach sollte auf zusätzliche Jodaufnahmen (insbesondere durch jodhaltige Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminpräparate) verzichtet werden. Besprechen Sie gegebenenfalls mit Ihrer behandelnden Ärztin, Ihrem Arzt oder einer Ernährungsfachkraft, ob die zusätzliche Einnahme von Jod unbedenklich für Sie ist.
Kann ich Jod auch durch andere Lebensmittel als Jodsalz zu mir nehmen?
Jod lässt sich nicht nur über das zum Salzen von Speisen zu Hause oder in der Gastronomie verwendete Jodsalz aufnehmen. Auch verarbeitete Lebensmittel wie Brot und Fleischerzeugnisse können mit Jodsalz hergestellt werden und damit zur Jodversorgung beitragen. Ein Blick in die Zutatenliste oder das Nachfragen in der Bäckerei oder Metzgerei lohnt sich. Gute Jodquellen sind außerdem Meeresfisch und –früchte. Auch Milch und Eier können jodreich sein, da das den Futtermitteln zugesetzte Jod in die entsprechenden Lebensmittel übergeht. Vorsichtig sollten Sie bei getrockneten Meeresalgen sein, da diese extrem hohe Jodgehalte aufweisen können. Beim Kauf dieser Produkte sollte daher darauf geachtet werden, dass eindeutige Angaben zum Jodgehalt und zur maximalen Verzehrmenge vorhanden sind.
Ich hatte den Eindruck, dass die Jodversorgung in Deutschland kein Problem mehr ist. Warum ist das jetzt wieder so wichtig?
Untersuchungen des Robert Koch-Institutes (RKI) zeigen, dass die Jodversorgung in Deutschland immer noch nicht optimal bzw. sogar rückläufig ist. Laut RKI nehmen 44 Prozent der Kinder und Jugendlichen und 32 Prozent der Erwachsenen weniger Jod zu sich, als es ihrem geschätzten durchschnittlichen Bedarf entspricht. Sie besitzen demnach ein erhöhtes Risiko für eine Jodunterversorgung. Gemessen an der Jodausscheidung im Urin herrscht in Deutschland laut Einstufung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wieder ein milder Jodmangel. Außerdem deuten die Ergebnisse einer Markterhebung der Universität Gießen darauf hin, dass die Verwendung von Jodsalz in verarbeiteten Lebensmitteln zurückgegangen ist. Um der rückläufigen Jodversorgung in der Bevölkerung entgegenzuwirken, informiert das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) im Rahmen der Informationsoffensive "Wenn Salz, dann Jodsalz" über die Bedeutung von Jod für die Gesundheit und sensibilisiert Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Lebensmittelwirtschaft für die Verwendung von Jodsalz. Gleichzeitig strebt das BMEL im Rahmen der Nationalen Reduktions- und Innovationsstrategie für Zucker, Fette und Salz in Fertigprodukten weiterhin eine Reduktion der Salzgehalte von verarbeiteten Lebensmitteln an.
Speisesalz, Tafelsalz oder Kochsalz?
Diese drei Begriffe meinen alle dasselbe: Salz, wie es in Handel und Haushalten zum Salzen von Lebensmitteln und Speisen genutzt wird und das es mit und ohne Jodzusatz gibt.
Welche speziellen rechtlichen Regelungen gelten für jodiertes Speisesalz?
Für die Herstellung von jodiertem Speisesalz sind gemäß § 2 Absatz 2 in Verbindung mit Anlage 2 der Verordnung über die Zulassung von Zusatzstoffen zu Lebensmitteln[1] die Mineralstoffverbindungen Kaliumjodat und Natriumjodat zugelassen.
Der Jodgehalt in jodiertem Speisesalz muss gemäß § 5a Absatz 2 der Verordnung über das Inverkehrbringen von Zusatzstoffen und einzelnen wie Zusatzstoffe verwendeten Stoffen[2] einschließlich des natürlichen Gehaltes mindestens 15 Mikrogramm Jod pro Gramm Salz betragen. Er darf einschließlich des natürlichen Gehaltes 25 Mikrogramm Jod pro Gramm Salz nicht übersteigen (gemäß § 2 Absatz 2 in Verbindung mit Anlage 2 der Verordnung über die Zulassung von Zusatzstoffen zu Lebensmitteln).
Wer jodiertes Speisesalz herstellen will, bedarf gemäß § 5a Absatz 1 der Verordnung über das Inverkehrbringen von Zusatzstoffen und einzelnen wie Zusatzstoffe verwendeten Stoffen einer entsprechenden Genehmigung. Diese wird durch die für den Antragstellenden zuständige Lebensmittelüberwachungsbehörde erteilt, wenn Sachkunde und Zuverlässigkeit des Antragstellenden sowie das Vorhandensein von Einrichtungen zu richtiger Dosierung und gleichmäßiger Durchmischung nachgewiesen werden.
Beim Verbringen von jodiertem Speisesalz nach Deutschland ist gemäß § 5a Absatz 3 und 4 in Verbindung mit Anlage 5 der Verordnung über das Inverkehrbringen von Zusatzstoffen und einzelnen wie Zusatzstoffe verwendeten Stoffen eine amtliche Bescheinigung der zuständigen Behörde des Herkunftslandes erforderlich. Diese ist nicht erforderlich, wenn jodiertes Speisesalz aus einem anderem Mitgliedstaat der EU, in dem es rechtmäßig im Verkehr ist, nach Deutschland verbracht wird oder wenn aus einem Drittland nach Deutschland verbrachtes jodiertes Speisesalz bereits in einem anderen Mitgliedstaat der EU rechtmäßig im Verkehr ist.
Kann eine erhöhte Jodzufuhr infolge von Maßnahmen zur Verbesserung der Jodversorgung Schilddrüsenerkrankungen fördern?
Langfristig wirkt eine verbesserte Jodversorgung Schilddrüsenerkrankungen entgegen. Eine tägliche Jodzufuhr in Höhe von maximal 500 μg pro Tag gilt als gesundheitlich unbedenklich und sicher. Zum Vergleich: Empfohlen werden laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung (DGE) 180 bis 200 μg Jod pro Tag bei Erwachsenen. Die derzeitige geschätzte Jodzufuhr beträgt laut Robert Koch-Institut bei über Dreiviertel der Erwachsenen in Deutschland unter 200 μg/Tag.
Bei Personen mit einer Schilddrüsenautonomie kann eine dauerhafte Überschreitung einer täglichen Jodzufuhr von 500 μg pro Tag eine Hyperthyreose (Schilddrüsenüberfunktion) auslösen. Bei einer Schilddrüsenautonomie produzieren Zellen der Schilddrüse unabhängig vom Bedarf Hormone. Betroffen sind vor allem Personen, die lange einem Jodmangel ausgesetzt waren. Da in Deutschland bis in die 1980er Jahre Jodmangel weit verbreitet war, können vorrangig ältere Menschen berührt sein. Eine derart hohe Jodzufuhr tritt jedoch selten auf, beispielsweise durch die zusätzliche Einnahme jodhaltiger Nahrungsergänzungsmittel, den Verzehr getrockneter Meeresalgen oder eine Jodsalzzufuhr, die um ein Vielfaches oberhalb der Empfehlungen für die tägliche Salzzufuhr liegt. Die Symptome einer jodinduzierten Hyperthyreose sind nahezu immer vorübergehend.
Langfristig dient eine ausreichende Jodversorgung aber der Prävention solcher Schilddrüsenerkrankungen.
Eine verbesserte Jodversorgung wird manchmal auch mit einem Anstieg der Häufigkeit von Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse in Verbindung gebracht. Der Zusammenhang zwischen der Jodzufuhr und Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse ist jedoch sehr komplex und die Studienlage nicht eindeutig. Genetische Faktoren spielen für das Auftreten von Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse eine wichtige Rolle. Die alleinige, kausale Assoziation einer verbesserten Jodversorgung mit der Entstehung von Autoimmunerkrankungen ist nicht belegt.
Weitere Informationen bieten die FAQs des Bundesinstituts für Risikobewertung.
Wie wird der Erfolg der Informationsoffensive zu Jodsalz bewertet?
Zur Beurteilung, ob die Maßnahmen zur Verbesserung der Jodversorgung in Deutschland ausreichend sind oder angepasst werden müssten, finden regelmäßige Untersuchungen zur Jodversorgung der Bevölkerung statt. Die aktuellsten repräsentativen Daten wurden im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) vom Robert Koch-Institut (RKI) erhoben. Künftig wird das Jodmonitoring in das derzeit neu aufgebaute Nationale Ernährungsmonitoring (nemo) am Max Rubner-Institut (MRI) integriert. Im Rahmen des nemo werden engmaschig umfassende und bundesweit repräsentative Daten zum Lebensmittelverzehr, zur Nährstoffzufuhr, zum Ernährungsstatus und zu weiteren Aspekten des Ernährungsverhaltens erhoben. Dabei wird auch Jod im Urin gemessen (empfohlene Methode zur Bewertung der Jodversorgung einer Bevölkerung) und die Teilnehmenden werden nach der Verwendung von Jodsalz im Haushalt gefragt. Mit neuen Ergebnissen zur Jodversorgung bei Erwachsenen basierend auf Urinanalysen ist frühestens Ende 2027 zu rechnen. Dann kann erstmalig seit Beginn der Informationsoffensive des BMEL eingeschätzt werden, wie sich die Jodversorgung in Deutschland entwickelt hat.
Weiterhin werden seit dem Jahr 2022 im Rahmen der Befragungen zum BMEL-Ernährungsreport unter anderem die Verbrauchereinstellungen gegenüber Jodsalz ermittelt. Zudem erhebt das MRI regelmäßig Daten zur Verwendung von Jodsalz in verarbeiteten Lebensmitteln im Rahmen des Produktmonitorings verpackter Lebensmittel der Nationalen Reduktions- und Innovationsstrategie für Zucker, Fette und Salz in Fertigprodukten sowie weiterer Untersuchungen von unverpackten Produkten.
Kann die Tierfütterung einen Beitrag zur Prävention eines Jodmangels leisten?
Bei entsprechender Jodzugabe zu den Futtermitteln können Milch und Eier eine Jodquelle sein, da das den Futtermitteln zugesetzte Jod in die entsprechenden Lebensmittel übergeht. Gerade Milch und Milchprodukte leisten in Deutschland gemäß den letzten repräsentativen Verzehrstudien (2014-2017 bei Kindern und Jugendlichen, 2005-2007 bei Erwachsenen) einen wichtigen Beitrag zur menschlichen Jodversorgung.
Die üblicherweise in der Fütterung von lebensmittelliefernden Tieren, zum Beispiel Kühen, eingesetzten Futtermittel sowie das Tränkwasser verfügen nicht über ausreichend hohe native Jodgehalte, um die Jodversorgung der Tiere sicherzustellen. Deshalb erfolgt eine zusätzliche Jodgabe zu den Futtermitteln. Hierfür sind in der Europäischen Union derzeit gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2015/861 drei Jodverbindungen (Kaliumjodid, Kalziumjodat, wasserfrei und gecoatetes Kalziumjodat-Granulat, wasserfrei) als Futtermittelzusatzstoffe für alle Tierarten zugelassen. Die Zulassung ist verbunden mit einer begrenzenden Höchstgehaltsregelung für die einzelnen Tierarten.
Kann Jodsalz Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen?
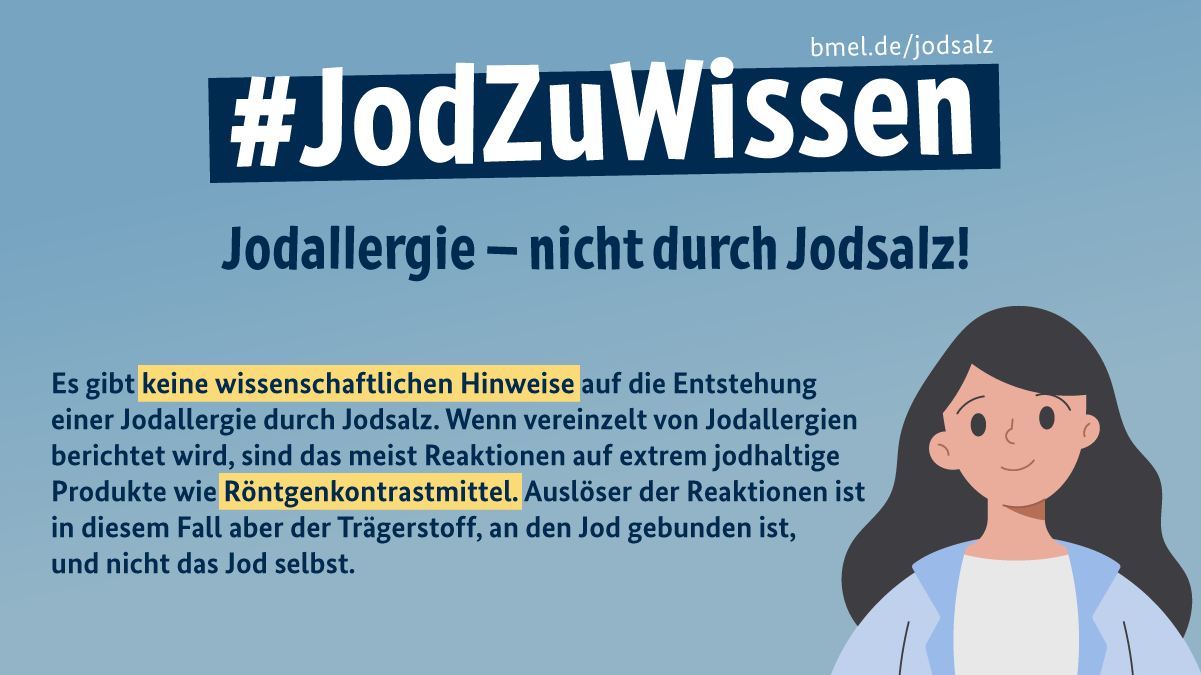

Allergien spielen bei der Verwendung von Jodsalz keine Rolle. Zwar können jodhaltige Produkte wie Röntgenkontrastmittel oder Wunddesinfektionsmittel Allergien auslösen, als Allergen wirkt aber in diesen Fällen der Trägerstoff, an den Jod gebunden ist, und nicht das Jod selbst. Unverträglichkeitsreaktionen gegenüber Jod können auftreten, wenn dauerhaft tägliche Jodmengen im Milligramm- oder Grammbereich aufgenommen werden, also eine weitaus höhere Jodzufuhr als durch Jodsalz. Eine Jodzufuhr in dieser Größenordnung kann beispielsweise durch die Einnahme jodhaltiger Medikamente oder den Verzehr getrockneter Meeresalgen zustande kommen.
Woran erkenne ich, ob ein Lebensmittel Jodsalz enthält?
Bei vorverpackten Lebensmitteln muss der Einsatz von Jodsalz im vorgeschriebenen Zutatenverzeichnis gekennzeichnet werden. Dabei kann es gemäß der europäischen Lebensmittel-Informationsverordnung auf zwei Arten im Zutatenverzeichnis aufgeführt werden:


- in Form seiner Einzelzutaten: „Salz“ sowie der konkret genutzten Mineralstoffverbindung, z. B. „Kaliumjodat“
- als zusammengesetzte Zutat: z. B. „Jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Natriumjodat)“ oder „Jodsalz (Salz, Kaliumjodat)“.
Bei unverpackten Produkten, die man zum Beispiel in der Bäckerei oder Metzgerei kauft, lohnt es sich, nachzufragen, welches Salz bei der Herstellung verwendet wurde.
Wo finde ich mehr verlässliche Informationen zu Jod und Jodsalz?
Es gibt zahlreiche gute Quellen, um sich weiter zu Jod und Jodversorgung in Deutschland zu informieren.
Das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) gibt umfassende Informationen zu Jod und Jodsalz.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) gibt Empfehlungen zur Jodzufuhr je nach Altersgruppe.
Der Arbeitskreis Jodmangel (AKJ) ist ein gemeinnütziger Verein, der seit 1984 intensive Aufklärung zur Jodversorgung und Schilddrüsengesundheit betreibt.
Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) beleuchtet die gesundheitlichen Risiken einer zu niedrigen oder zu hohen Jodzufuhr.
Das Robert Koch-Institut (RKI) informiert über die Jodversorgung in Deutschland.
Das Max Rubner-Institut (MRI, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel) hat u. a. Untersuchungen zur Verwendung von Jodsalz in verarbeiteten Lebensmitteln und zur Stabilität von Jodsalz bei der Lebensmittelverarbeitung durchgeführt.
