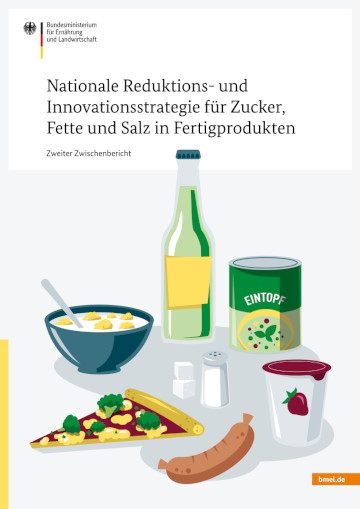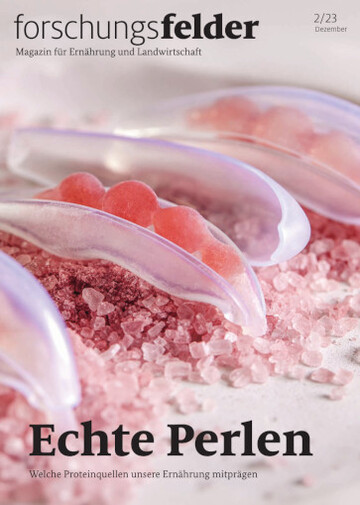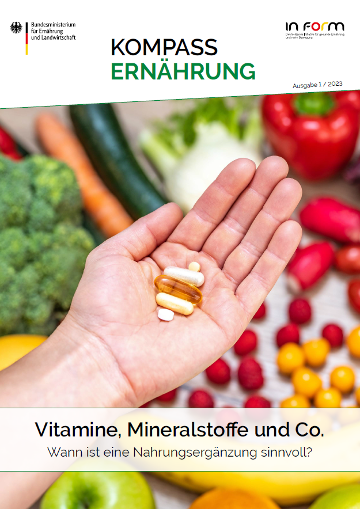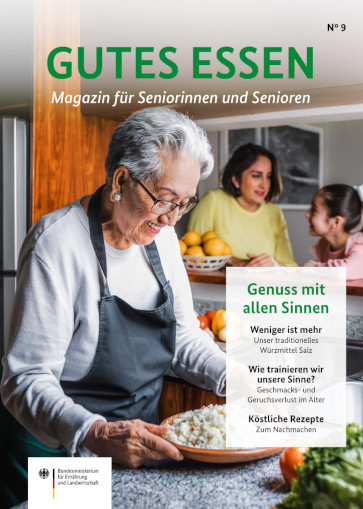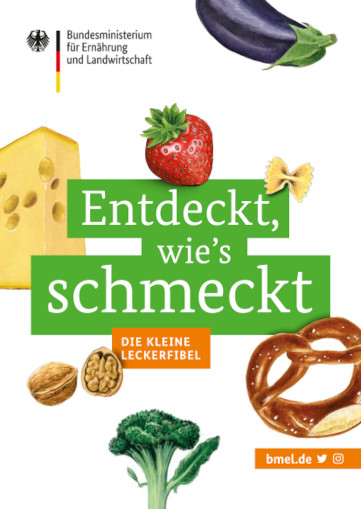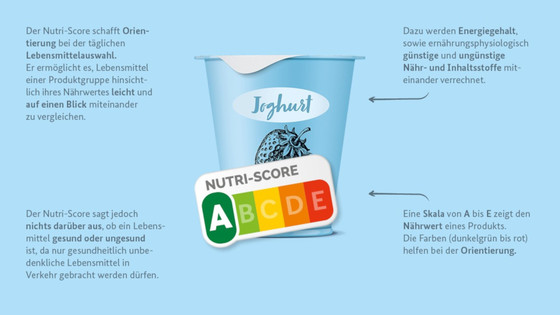Fragen und Antworten zu Lebensmittelkontrollen in Deutschland
Wie viele Lebensmittelkontrolleure gibt es pro Landkreis und Einwohner?
Die amtliche Lebensmittelüberwachung in Deutschland ist nach dem Grundgesetz Aufgabe der Bundesländer. Sie entscheiden daher in eigener Verantwortung, mit welchem Personal die Überwachungsaufgaben in ihrem Bundesland wahrgenommen werden.
Wie oft und in welchem Rhythmus müssen die Kontrollen im Laufe eines Jahres durchgeführt werden?
Für die Kontrollhäufigkeit von Lebensmittelbetrieben sind in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift Rahmen-Überwachung (AVV RÜb) sogenannte Regelkontrollfrequenzen festgelegt. Diese richten sich nach dem Gefährdungspotenzial für die Verbraucherinnen und Verbraucher, d.h. je höher das Gefährdungspotenzial für die Verbraucherinnen und Verbraucher ist, desto häufiger werden die Lebensmittelbetriebe kontrolliert.
Um das Risiko zu ermitteln, bewerten die Länder die ansässigen Lebensmittelbetriebe nach festgelegten Kriterien (risikoorientierte Betriebsbeurteilung) und ordnen sie verschiedenen Risikoklassen zu. Als Kriterien werden im Wesentlichen vier Merkmale herangezogen:
- Betriebsart
- Verhalten des Unternehmers
- Verlässlichkeit der Eigenkontrollen
- Hygienemanagement
Für die verschiedenen Risikoklassen sind entsprechend Kontrollfrequenzen von mindestens wöchentlich bis alle 3 Jahre vorgeschrieben.
Darüber hinaus legt die AVV RÜb die jährliche Anzahl der im Rahmen der amtlichen Überwachung zu entnehmenden Lebensmittelproben fest. Sie beträgt fünf Lebensmittelproben pro 1.000 Einwohner. Bei 83 Millionen Einwohnern in Deutschland sind dies bundesweit ca. 415.000 Lebensmittelproben pro Jahr.
Wie hoch ist der Anteil angekündigter und unangekündigter Besuche bei Lebensmittelkontrollen?
Die Lebensmittelüberwachung hat nach EU-Recht grundsätzlich unangemeldet zu erfolgen. In bestimmten Fällen schreibt das EU-Recht jedoch eine vorherige Anmeldung einer Betriebskontrolle vor, wenn die Kontrolle sonst nicht durchgeführt werden kann. Dies kann z.B. aufgrund geografischer Gegebenheiten (z.B. sehr abgelegene Betriebe) oder besonderer Betriebsarten (z.B. mobile Betriebe wie Schiffe) der Fall sein. Es gibt kein festes Verhältnis zwischen angemeldeten und unangemeldeten Inspektionen; unangemeldete Inspektionen sind jedoch die Regel.
In welchem Verhältnis stehen verdachtsunabhängige Stichprobenkontrollen zu Verdachtskontrollen?
Neben den Regelkontrollen, die in Abhängigkeit von der ermittelten Risikokategorie durchgeführt werden, siehe hierzu auch diese Antwort, finden Anlasskontrollen (z.B. aufgrund von Beschwerden, Nachkontrollen) statt. Die Länder führen die Kontrollen in eigener Zuständigkeit und nach Bedarf durch. Daher liegen dem Bund keine allgemeingültigen Informationen über das Verhältnis von Regel- und Anlasskontrollen vor.
Auf welcher Rechtsgrundlage stehen Lebensmittelkontrollen?
Zwei EU-Verordnungen gehören zu den zentralen Säulen des Rechts der Sicherheit von Lebensmitteln: die Basisverordnung EG Nr. 178/2002 und die sogenannte Kontrollverordnung (EU) 2017/625.
Die Basisverordnung aus dem Jahr 2002 formuliert einen umfassenden Rechtsrahmen für die gesamte Lebensmittelkette - "vom Acker bis auf den Teller". Die Verordnung enthält die Grundprinzipien des allgemeinen Lebensmittelrechts. Zu den allgemeinen Grundsätzen und Anforderungen für das Inverkehrbringen von Lebens- und Futtermitteln in der Basisverordnung gehören insbesondere
- Schutz der Gesundheit der Verbraucherinnen und Verbraucher,
- der Schutz vor Irreführung und Täuschung,
- das Vorsorgeprinzip,
- die Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln sowie
- die unternehmerische Eigenverantwortung.
Das bedeutet, dass die Hauptverantwortung für die Sicherheit und Qualität von Lebensmitteln bei den Unternehmen liegt. Sie müssen sicherstellen, dass die von ihnen in Verkehr gebrachten Produkte die Gesundheit der Verbraucherinnen und Verbraucher nicht gefährden und in jeder Hinsicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen durch die Unternehmen wird von der amtlichen Lebensmittelüberwachung und den Veterinärbehörden der Länder stichprobenartig und risikoorientiert kontrolliert („Kontrolle der Kontrolle“).
Die Anforderungen an die amtliche Lebensmittel- und Betriebsüberwachung sind in der Lebensmittelüberwachungsverordnung festgelegt. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere EU-Verordnungen und Richtlinien, deren gemeinsames Ziel es ist, ein einheitliches Niveau zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Gesundheitsgefahren und Täuschung zu gewährleisten.
In Deutschland ist nach grundgesetzlicher Kompetenzordnung jedes Bundesland selbst dafür zuständig, die amtlichen Kontrollen nach diesen Vorgaben zu planen und durchzuführen. Damit dies bundesweit einheitlich und koordiniert geschieht, wurden mit der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift Rahmenüberwachung (AVV RÜb) einheitliche Grundsätze hierfür festgelegt.
Weitere Informationen und Berichte finden Sie auf der Homepage des Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit.