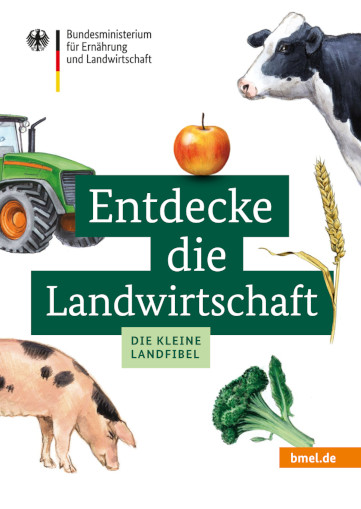Für die deutsche Weinbaubranche liegt Wandel in der Natur der Sache
Rede von Bundesminister Cem Özdemir beim Deutschen Weinbauverband zum 150-Jährigen Jubilläum am 20. Juni 2024 in Neustadt an der Weinstraße
Es gilt das gesprochene Wort!
Anrede,
Wein ist Demokratie im Glas. Wie ich darauf komme? Wir befinden uns hier am Fuße des Hambacher Schlosses. Hier haben sich vor 192 Jahren 30.000 Menschen versammelt, um für Freiheit, Einheit und demokratische Rechte zu demonstrieren. Das Hambacher Fest gilt als Geburtsstunde der Demokratie – und der Weinbau hatte einen nicht unerheblichen Anteil am Erfolg des Hambacher Festes. Denn unter den Teilnehmenden waren auch viele einheimische Winzerinnen und Winzer. Sie haben wie viele andere für demokratische Grundwerte wie Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit sowie die Gleichberechtigung von Frauen und Männern demonstriert.
Auf dem Hambacher Fest wurde leidenschaftlich diskutiert, es wurden Freiheitslieder gesungen und natürlich auch Wein getrunken – aus einem Pfälzer Schoppenglas, vermute ich. Kurzum: Weinbau und Weinkultur sind ein wichtiger Bestandteil dieses historischen Moments. Wir sehen auch daran, dass Wein mehr ist als ein Getränk. Es ist ein lebendiges Kulturgut, das Tradition und Moderne miteinander vereint. Für die Region ist Weinbau ein starker Wirtschaftsfaktor. Er sorgt für vielfältige Arbeitsplätze im ländlichen Raum: von der Produktion über die Kellermeister bis hin zur Vinothek und natürlich im Tourismus.
Lieber Herr Schneider,
der Deutsche Weinbauverband vertritt seit 150 Jahren den Weinbau und damit einen bedeutenden Teil der Kultur und Wirtschaft unseres Landes. Als Dachverband vertreten Sie auch politisch die Interessen der deutschen Winzerinnen und Winzer auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Für mein Ministerium sind Sie ein unverzichtbarer Ansprechpartner, der die Weinbaupolitik maßgeblich mitgestaltet. Nicht zuletzt ist der Deutsche Weinbauverband ein wichtiger Botschafter unserer Weinbauregionen. Er trägt wesentlich dazu bei, das Ansehen unserer Weinlandschaften national und international zu steigern. 150 Jahre! Herzlichen Glückwunsch! Und Danke für Ihren unermüdlichen Einsatz! Hier, im Saalbau, findet die alljährliche Wahl der Deutschen Weinkönigin statt.
Liebe Frau Brockmann, Ihr Amt steht auf eindrucksvolle Weise für die Verbindung von Tradition und Moderne. Denn es bewahrt das kulturelle Erbe des deutschen Weinbaus und bringt gleichzeitig frischen Wind und zeitgemäße Impulse in die Branche. Danke für Ihr Engagement für den deutschen Wein!
Meine Damen und Herren,
der deutsche Weinbau prägt unser Land seit Jahrhunderten nicht nur kulinarisch – er formt auch die herrlichsten Kulturlandschaften: Wer angereist ist, konnte es mit eigenen Augen sehen: Die Weinlagen der Mittelhaardt gehören nicht nur zu den besten Riesling-Lagen, sondern auch zu den schönsten. Der deutsche Weinbau leistet aber auch einen bedeutenden Beitrag zur Biodiversität. Weinberge beherbergen zahlreiche Tier- und Pflanzenarten.
Hecken, Trockenmauern und kleine Wasserstellen bieten zusätzlichen Lebensraum und erhöhen die ökologische Vielfalt. Gerade naturnah bewirtschaftete Weinberge bieten Rückzugsorte für seltene und bedrohte Arten. Darüber hinaus tragen alte Rebsorten, die in Deutschland kultiviert werden, zur genetischen Vielfalt bei. Die Begrünung der Rebzeilen fördert die Bodenfruchtbarkeit, schenkt Lebensraum für Insekten, Vögel und Kleintiere und verhindert Erosion – ein wichtiger Aspekt, wenn wir an die Starkregenfälle der vergangenen Wochen denken! Ein Weinberg ist eben immer beides: schützenswerte Natur und wertvolles Kulturgut. Und es ist unsere gemeinsame Verantwortung, diesen einzigartigen Schatz zu bewahren und zu fördern. Lieber Herr Dr. Hoffmann, Sie werden uns später noch mehr und kenntnisreicher über den Lebensraum Weinberg berichten. Ich freue mich darauf!
Für die deutsche Weinbaubranche liegt Wandel in der Natur der Sache – und ich finde es bewundernswert, wie resilient und anpassungsfähig unsere Weinbaubetriebe sind. Dennoch: Der Druck ist immens. Die aktuellen Herausforderungen sind groß. Sie sind geprägt durch eine Kombination aus klimatischen Veränderungen, wirtschaftlichen Unsicherheiten und sich wandelnden Konsumentenpräferenzen. Die Marktlage bleibt in allen Mitgliedstaaten der EU angespannt. Auch Drittländer kämpfen mit Überschüssen.
Es wird weltweit mehr Wein erzeugt als konsumiert. Der Absatz von Wein ist rückläufig, da spielt sicher auch die Inflation eine Rolle. Die Konsumenten konzentrieren sich beim Einkauf verstärkt auf Grundnahrungsmittel, zu denen der Wein vielleicht hier in der Pfalz, aber eben nicht bei allen Menschen zählt. Gleichzeitig sind die Preise für Dünger, Energie, Flaschen, Transport und Verpackung deutlich gestiegen. Dies führt dazu, dass viele Winzerinnen und Winzer nicht nur mit Absatzproblemen zu kämpfen haben, sondern auch nicht immer die Preise erlösen können, die zur Deckung der Kosten erforderlich wären.
Die immer stärker spürbaren Folgen der Klimakrise stellen die wohl größte Herausforderung auch für den Weinbau dar. Einerseits führen längere Vegetationsperioden und höhere Temperaturen dazu, dass bestimmte Rebsorten nun besser gedeihen – Rebsorten, die früher als problematisch galten. Andererseits stellen Extremwetterereignisse die Winzerinnen und Winzer vor erhebliche Herausforderungen. Ich denke hier an vergangene Hitzewellen im Sommer, Hagel und Starkregen. Aber auch der diesjährige Frost im April kurz nach dem Austrieb schlägt natürlich ins Kontor.
Ich habe mich beim letzten Agrarrat in Brüssel vehement für Gegenmaßnahmen und Entlastungen für die Weinbaubetriebe eingesetzt. Der Weinbau braucht jetzt zielgerichtete Unterstützung. Eine weitere Krisendestillation löst das Problem aus meiner Sicht nicht. Um den Markt wieder ins Gleichgewicht zu bekommen, kann ein EU-weites Rodungsprogramm in Verbindung mit einem Anbaustopp helfen – dafür habe ich in Brüssel geworben. Die Kommission hat nun in einem ersten Schritt zugesagt, zügig eine Expertengruppe einzusetzen. Das ist ein erster Schritt. Er darf aber nicht bedeuten, dass wir Lösungen auf die lange Bank schieben. Wichtig sind schnelle und konkrete Ergebnisse – und da werde ich auch dranbleiben!
Unabhängig davon ist es wichtig, sich auf die klimatischen Veränderungen einzustellen. Es gibt sicher keine Patentlösung: Wo genug Wasser vorhanden, wird sicher die Tröpfchen-Bewässerung weiter Einzug halten. Es führt auch kein Weg daran vorbei, den Anbau pilzfester Sorten, die PIWIs, zu forcieren, um Pflanzenschutzmittel einzusparen und den Maschineneinsatz im Weinberg zu reduzieren. Selbstverständlich werden PIWIs niemals die klassischen Sorten ersetzen können. Das sollen sie auch nicht. Aber bei weniger als 3 Prozent Flächenanteil ist noch Luft nach oben. Sicherlich bedarf es dazu auch Rebsorten, die die entsprechenden Weinqualitäten hervorbringen. Doch davon gibt es heute schon einige – und es werden immer mehr! Mit dem Institut für Rebenzüchtung in Siebeldingen haben wir auch in Sachen pilzwiderstandsfähiger Rebsorten eine Vorzeigeeinrichtung. Auch die Lehr- und Forschungsanstalten der Länder haben auf dem Gebiet Beachtliches vorzuweisen.
Auf Konsumentenseite gibt es einen deutlichen Trend hin zu nachhaltig und ökologisch produzierten Weinen. Viele deutsche Weinbaubetriebe haben darauf reagiert und ihre Produktion auf biologischen oder biodynamischen Weinbau umgestellt. Aber auch das geht nicht von heute auf morgen. Rebenzüchtung, die Bereitstellung von Pflanzgut durch Rebschulen, die Umstellung der Weinberge auf resistente Sorten und die Entwicklung und Zulassung neuartiger Pflanzenschutzmittel für den ökologischen und biologischen Landbau brauchen Zeit. Zurzeit fördern wir im Rahmen des Bundesprogramms Ökologischer Landbau mehrere Forschungsvorhaben. Sie haben einerseits die Gesunderhaltung der Reben, andererseits die Bewertung der Leistungen des Öko-Landbaus zum Ziel.
Ob öko oder konventionell, unterm Strich, zeigt sich die Branche anpassungsfähig und innovativ. Es ist die Aufgabe der Politik sie zu unterstützen. Und das tun wir! Neben den bereits erwähnten Initiativen in Brüssel wären da an erster Stelle die Maßnahmen des Weinsektorenprogramms im Rahmen des GAP-Strategieplans zu nennen: Investitionsförderung, Umstellung und Umstrukturierung von Rebflächen, Absatzförderung und Unterstützung bei der Ernteversicherung. Das sind rund 37 Millionen Euro im Jahr! Außerdem wollen wir Sie von unnötigen Bürokratielasten befreien. Deshalb prüfen wir derzeit, welche Erleichterungen wir bei Auflagen oder welche Beschleunigungen wir bei Verfahren erreichen können. Darüber hinaus werden wir bis nächstes Jahr die neue Geoschutzverordnung umsetzen. Wir wollen dabei prüfen, an welcher Stelle wir die Schutzgemeinschaften stärken können.
Und damit, meine Damen und Herren,
wären wir bei den Herkünften! Das Erfolgsrezept und folglich die Zukunft der deutschen Weine liegt in ihrer kontinuierlichen Weiterentwicklung und Diversifizierung. Die Menschen legen zunehmend Wert auf Regionalität, auf Herkunftsprofile und ausdrucksstarke Weine. Deswegen ist der eingeschlagene Weg der Umsetzung einer Herkunftspyramide im neuen Deutschen Weinrecht auch absolut folgerichtig. Dabei stehe ich den Vorschlägen der Wirtschaft offen gegenüber, eine Lagenklassifizierung einzuführen, um Spitzenerzeugnisse, wie das Großes Gewächs zu profilieren. Herkunftsprofilierung ist ein wichtiges Instrument zur Qualitätssicherung und liefert Weintrinkerinnen und Weintrinkern wertvolle Informationen zu Qualität und Charakter des Weines. Für die deutschen Winzerinnen und Winzer ist es eine einzigartige Chance, ihre Regionen und Lagen in den Vordergrund zu stellen. Und damit eine unverwechselbare Identität zu schaffen. Das stärkt das Image des deutschen Weines auch im globalen Markt.
Meine Damen und Herren,
vor 192 Jahren wurden hier, in Neustadt an der Weinstraße, zum ersten Mal die schwarz-rot-goldenen Fahnen geschwungen. Das war Patriotismus im besten Sinne. Wein ist Patriotismus im besten Sinne, denn er feiert die regionale Identität und Vielfalt – besitzt gleichzeitig die Fähigkeit, Nationen und Kulturen zu verbinden. Hier denke ich auch an die Internationale Organisation für Rebe und Wein, in der Deutschland neben 48 anderen Mitgliedstaaten vertreten ist. Schön, dass Sie heute hier sind, lieber John Barker! In Zeiten wie den Heutigen ist es wichtig, uns auf unsere demokratischen Wurzeln zu besinnen. Uns klar zu machen, wie kostbar Demokratie ist. Wie hart sie erkämpft wurde. Und wie bedeutend es ist, sie jeden Tag zu verteidigen. Vor diesem Hintergrund bedeutet Wein im Glas immer auch Demokratie im Glas. Und vielleicht sollten wir im Bundeskabinett häufiger einen Pfälzer Wein trinken – denn vielleicht ist das ein Grund, warum die Ampel in Rheinland-Pfalz etwas unaufgeregter regiert als wir in Berlin. Das wird sie wohl auch in Zukunft tun, mit einem Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer, der ja von der Südlichen Weinstraße kommt! In diesem Sinne wünsche ich dem Deutschen Weinbauverband weiterhin viel Erfolg!
Und uns allen einen schönen Abend, hier, in der Wiege der Demokratie.
Vielen Dank.
Ort: Neustadt an der Weinstraße