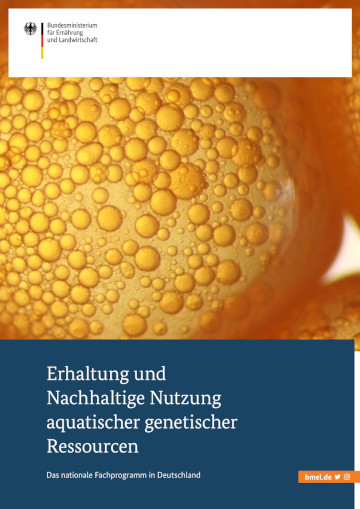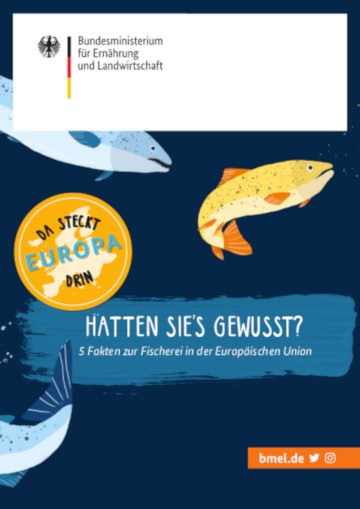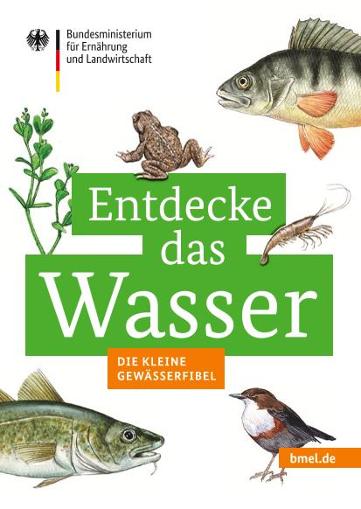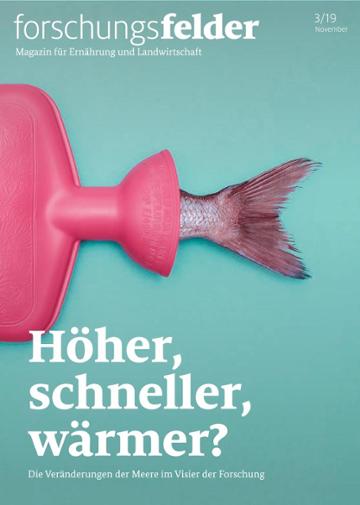Gemeinsame Fischereipolitik der EU
Die im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik der EU (GFP) erlassenen Bestimmungen zielen vor allem auf die nachhaltige, umweltverträgliche Bewirtschaftung der Fischbestände, die Förderung einer wettbewerbsfähigen Fischwirtschaft und die Stabilisierung der Märkte für Fischereierzeugnisse.
Nachhaltige Bewirtschaftung der Fischbestände
Eine nachhaltige Bewirtschaftung der Fischbestände, mit strengen Vorgaben für den Wiederaufbau von Fischbeständen in schlechtem Zustand sowie einem modernen Fischereimanagement, ist das wichtigste Prinzip der GFP.
Im Jahr 2021 wurden weltweit 62 % der wirtschaftlich genutzten Fischbestände nachhaltig bewirtschaftet. Es befinden sich global gesehen dennoch noch viele der wirtschaftlich genutzten Fischbestände in einem schlechten Zustand. Diese sind überfischt oder von Überfischung bedroht. Dies traf in der Vergangenheit auch auf viele Bestände in den EU-Gewässern zu. Im Jahr 2021 wurden hingegen fast 80 Prozent der Bestände im Nordostatlantik nachhaltig bewirtschaftet. (Quelle: FAO 2024: The State of World Fisheries ans Aquaculture 2024.)
Um eine nachhaltige Bewirtschaftung der Fischbestände zu gewährleisten, enthält die GFP Bestimmungen darüber,
- wie viel gefischt werden darf (Höchstfangmengen und Quoten),
- wie und wo gefischt werden darf (Technische Maßnahmen),.mit welcher Intensität gefischt werden darf (Fischereiaufwand),
Zur Durchsetzung dieser Regeln sieht das EU-Recht umfassende Fischereikontrollen vor.
Höchstmöglicher Dauerertrag
Die von der Flotte der EU bewirtschafteten Fischbestände werden nach dem Prinzip des höchstmöglichen Dauerertrages (Maximum Sustainable Yield, MSY) bewirtschaftet. So wird sichergestellt, dass aus einem Bestand, unter den gegebenen Umweltbedingungen, auf Dauer nur die Menge Fisch entnommen wird, die den Fortpflanzungsprozess des Bestandes nicht erheblich beeinträchtigt. Dieses Prinzip sichert die nachhaltige Nutzung der Bestände und ist Grundlage einer wirtschaftlich und ökologisch tragfähigen Fischerei.
Pflicht zur Anlandung
Wesentlicher Bestandteil der GFP ist der Grundsatz des Anlandegebots, welches seit 1. Januar 2019 für alle Fischereien auf regulierte Arten in Nordsee, Nordostatlantik und Ostsee gilt.
Die Pflicht zur Anlandung sieht vor, dass auch untermaßige Tiere der Zielart sowie Beifänge anderer Arten angelandet werden müssen und nur noch in bestimmten, eng begrenzten Ausnahmefällen über Bord geworfen werden dürfen.
Durch diese Regelungen wird der Rückwurf von unerwünschten und untermaßigen Fischen auf ein Mindestmaß reduziert, so dass einer unnötigen und nicht akzeptablen Vergeudung wertvoller Meeresressourcen entgegengewirkt wird. Allerdings wirkt die Pflicht zur Anlandung durch eine Reihe von Ausnahmen bisher nicht voll umfänglich, was immer wieder auch zu Kritik führt.
Mehrjahrespläne für die einzelnen Meeresbecken
Um überfischten Beständen Erholung zu ermöglichen und sie wieder auf ein Niveau zu bringen, das langfristig den höchstmöglichen Dauerertrag gewährleistet, werden diese allgemeinen Elemente der GFP in sog. Mehrjahresplänen für die einzelnen Meeresbecken umgesetzt, u.a. auch für die Nord- und Ostsee. Diese Mehrjahrespläne setzen konkrete Ziele für eine nachhaltige Bewirtschaftung und legen insbesondere Regeln zur jährlichen Festsetzung der Fangmengen für die jeweilige Fischerei fest.
Höchstfangmengen und Quoten
Die zentrale fischereipolitische Maßnahme zur Sicherung einer nachhaltigen Bestandsbewirtschaftung ist die jährliche Festlegung von Höchstfangmengen (TAC/Total Allowable Catches) für einzelne Fischbestände durch die Fischereiministerinnen und -minister der EU-Mitgliedstaaten. Da die Verfassung von Beständen der gleichen Fischart je nach Fanggebiet und den dort vorherrschenden Einflussfaktoren sehr unterschiedlich sein kann, werden die Höchstfangmengen für die einzelnen Meeresregionen jeweils gesondert für einen gewissen Zeitraum, regelmäßig für ein Kalenderjahr, festgelegt.
Grundlage für die Festsetzung sind neben den geltenden Bestimmungen der Mehrjahrespläne wissenschaftliche Empfehlungen auf der Basis fischereibiologischer Untersuchungen, die insbesondere vom Internationalen Rat für Meeresforschung (ICES) veröffentlicht werden.
Viele Bestände, darunter die meisten Nordsee-Bestände, werden von der EU gemeinsam mit Großbritannien, Norwegen, Island und den Faröer-Inseln bewirtschaftet. Entsprechende Vereinbarungen mit diesen Staaten finden ebenso Eingang in die jährlichen Beschlüsse über die Höchstfangmengen und Quoten wie die Ergebnisse weiterer Verhandlungen auf Ebene sogenannter Regionaler Fischereiorganisationen.
Die der EU zur Verfügung stehenden Fangmöglichkeiten werden nach einem festen Schlüssel auf die EU-Mitgliedstaaten aufgeteilt: dem Prinzip der relativen Stabilität, das ein wichtiger Eckpfeiler der Gemeinsamen Fischereipolitik ist und allen Mitgliedstaaten prozentual gleichbleibende Anteile an den maximal zulässigen Fangmengen garantiert.
Technische Maßnahmen
Die Festlegung maximal zulässiger Fangmengen alleine reicht aber nicht aus, um eine nachhaltige und umweltverträgliche Fischerei zu gewährleisten. Sie wird daher durch weitere technische Maßnahmen ergänzt und unterstützt.
Diese legen fest, wie und wo gefischt werden darf, um sicherzustellen, dass im Netz nur die Fische landen, die auch wirklich erwünscht sind, Jungfische und Nicht-Zielarten aber möglichst geschont werden. Dazu zählen:
- Mindestmaschenweite für Netze,
- Mindest-Anlandegrößen,
- Schongebiete und Schonzeiten,
- Beschränkungen von Beifängen,
- verpflichtende Verwendung selektiver Fanggeräte,
- Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden an der Meeresumwelt.
Die GFP unterliegt einer regelmäßigen umfassenden Bewertung, um zu gewährleisten, dass sie mit den aktuellen Entwicklungen von Umwelt und Fischerei Schritt halten kann und so dauerhaft die nachhaltige Bewirtschaftung der Bestände sicherstellen kann.